Das Sars-CoV-2-Virus, auch unter dem einfacher von der Zunge gehenden Namen „Corona-Virus“ bekannt, ist zurzeit das mediale Thema Nummer eins. Eine schwierig einzuschätzende Bedrohung mischt sich mit ungewohnten Einschränkungen des täglichen Lebens und einer Live-Berichterstattung ungekannten Ausmasses. Die Reaktionen auf die Pandemie und auf die vom Bund erlassenen Gegenmassnahmen reichen von vereinzelten Fällen der Panik und einigen wenigen «Hamsterkäufen» bis hin zu Ignoranz und Belustigung. Zeit, für einige Gedanken und Hintergründe zur aktuellen Pandemie und ihrem Kontext.
von Matthias Kern (BFS Zürich)
Wie gefährlich ist das Corona-Virus?
Zuerst einmal macht es wohl Sinn, dass wir uns etwas mit der Gefährlichkeit des aktuellen Virus beschäftigen, welches das unter «Covid-19» bekannt gewordene Krankheitsbild auslöst. Dabei hilft es nichts, wenn wir das Virus als «Erkältungsvirus» verharmlosen, noch wenn wir es mit der Pest oder der Spanischen Grippe vergleichen.
Grundsätzlich werden in der Diskussion um die Gefährlichkeit des Virus gerne zwei Ebenen durcheinandergebracht, die es zu trennen gilt. Einerseits ist das die Frage, ob das Virus gefährliche gesellschaftliche Auswirkungen in einem globalen Massstab haben kann und andererseits die Frage, ob es für uns als Individuen gefährlich sei, am Corona-Virus zu erkranken. Die Antwort auf die erste Frage lautet Ja, die auf die zweite in einem grossen Teil der Fälle Nein.
Der österreichische Aktivist Fabian Lehr schreibt dazu: «Es ist ja seit längerem bekannt, dass die Sterblichkeit beim Coronavirus weit unter der von Mers und Sars liegt. Seit dem massenhaften Auftreten von Covid-19 liegt die Sterblichkeit konstant bei etwa 2%. Und diese Zahl muss man tatsächlich wohl noch einschränken. Erstens, weil es bei Covid-19 massenhaft Fälle gibt, die so milde verlaufen, dass die Infizierten sich gar nicht ernstlich krank fühlen und sich nie bei einem Arzt melden. Die 2% Sterblichkeit beziehen sich auf diejenigen Fälle, deren Verlauf so gravierend ist, dass die Leute in einem Krankenhaus landen. Solche leichten, nicht behandlungsbedürftigen Verläufe gibt es bspw. bei Mers nicht. Zweitens, weil Covid-19, ähnlich wie die saisonale Grippe, überwiegend für ältere, körperlich bereits kranke und stark geschwächte Menschen lebensgefährlich sein kann. Für einen bisher einigermaßen gesunden Menschen jungen oder mittleren Alters liegt die Sterblichkeit beim Coronavirus sehr wahrscheinlich weit unter 1%. Will sagen: Einem bisher gesunden 20-30- oder 40-Jährigen, der am Coronavirus erkrankt, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überhaupt nichts Schlimmeres passieren als bei einer normalen Erkältung, und auch für einen chronisch kranken 60-Jährigen ist die Wahrscheinlichkeit, nach ein paar Wochen wieder gesund und munter zu sein, weitaus höher als die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Das Coronavirus ist kein Killervirus, es ist keine neue Pest und für die sehr große Mehrheit der Infizierten gar kein Grund zu ernster Beunruhigung.
Aber: Das Virus ist, erstens, extrem ansteckend, sodass es, wenn sich eine Pandemie tatsächlich nicht mehr vermeiden lässt, in sehr kurzer Zeit enorm viele Menschen infizieren wird. Wie gesagt: Den allermeisten dieser Infizierten wird überhaupt nichts Schlimmes passieren, aber die gleichzeitige Infektion von dutzenden oder gar hunderten Millionen Menschen wird potenziell Wirtschaftsleben und Infrastruktur monatelang lähmen und damit sehr gravierende Auswirkungen auf die ohnehin kriselnde Weltwirtschaft haben. Zweitens: Covid-19 droht sich dauerhaft als saisonale Erkrankung einzunisten. Die Sterblichkeit des Virus ist zwar nicht hoch, aber doch ein gutes Stück höher als die der normalen saisonalen Grippe. Wenn die Welt nun jedes Jahr neben der Erkältungs- und Grippesaison auch eine Covid19-Saison erleben sollte, bedeutet das jedes Jahr zehntausende bis hunderttausende zusätzliche Tote, auch wenn 99% der Infizierten die Krankheit überleben. Die Masse macht’s. Eine Krankheit, die jedes Jahr zig Millionen Menschen befällt, sorgt auch für eine schlimme Zahl Todesopfer, wenn die Sterblichkeit nur 1-2% beträgt.»
Schauen wir uns an, was das für die Schweiz bedeuten könnte. Marc Salathé, Professor für Epidemiologie an der EPFL in Lausanne trägt dazu die wichtigsten Zahlen zusammen. Bislang wird in der Schweiz täglich ungefähr 1 Fall von Covid-19 pro 100’000 Einwohner*innen bekannt. Aus China wissen wir, dass sich diese Zahl ungefähr jede Woche verdoppelt. Ohne Massnahmen zur Eindämmung der Virus-Verbreitung wären wir damit Ende April bei ca. 500 Fällen pro 100’000 Einwohner*innen angelangt, wovon rund 5%, also 25/100’000, in stationärer Behandlung wären. Damit wären 5% aller Schweizer Hospitalisierungen durch Covid-19 verursacht. Ende Mai hingegen wären bereits 10% der Bevölkerung infiziert und ausnahmslos jedes Krankenhausbett durch Covid-19-Patient*innen belegt. Die Konsequenzen einer solchen Krankheitswelle kann sich jede und jeder selbst vorstellen. Die Gefahr dafür ist durchaus realistisch.
Es ist also angesichts dieser beunruhigenden wissenschaftlichen Erkenntnisse unbedingt notwendig, dass Massnahmen gegen das Virus getroffen werden. Seine Sterblichkeit ist ungefähr 10 Mal höher wie bei der Grippe und die Übertragungsrate hoch. Eine Pandemie wird praktisch nicht mehr aufzuhalten sein, darüber herrscht mittlerweile auch unter Expert*innen grösstenteils Konsens. Eine durch wirksame Vorsorgemassnahmen herbeigeführte Verzögerung der Erkrankungen gäbe dem Gesundheitssystem jedoch die Möglichkeit, sich besser vorzubereiten und angesichts eines langsamen Anschwellens der Fälle mehr Menschen eine Behandlung zu ermöglichen.
Der Bund hat für die Schweiz einige Massnahmen ergriffen, die genau eine solche Verzögerung bewirken sollen. Und zwar hat er in erster Linie Veranstaltungen mit über 1’000 Personen verboten und Verhaltensregeln herausgegeben. Über diese Massnahmen kann man sich streiten – und über diese Massnahmen wird auch gestritten. Vermutlich sind die Massnahmen grundsätzlich sinnvoll (so zumindest die Expert*innen), haben aber problematische Konnotationen und Nebeneffekte.
Interessen des Bundes und die verhängten Massnahmen
Der Bund reagierte bislang für die Schweiz mehr oder weniger im selben Rahmen, den wir auch in vielen anderen Ländern beobachten können. Wie bereits erwähnt ist das Ziel der erlassenen Massnahmen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen und so insbesondere dem Gesundheitssystem Zeit zu geben zu reagieren und sich vorzubereiten.
Gleichzeitig hat ein bürgerlicher Staat natürlich ein Interesse daran, die Auswirkungen von Covid-19 so gut möglich einzudämmen, denn das Virus führt nicht nur zu gesundheitlichen Problemen und zum Tod von vor allem älteren Menschen, sondern durch eine allfällige massenhafte Erkrankung auch zu einer geradezu einschneidenden Wirkung auf die Entwicklung der Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben.
Man kann sich natürlich fragen, ob die Massnahmen des Bundes nicht ein Stück weit willkürlich sind, und ob eine Grenze von 1’000 Personen wirklich sinnvoll ist. Andererseits schlägt das besonders von linker Seite gerne aufgebrachte Gegenargument: «Der Staat schützt nur die Wirtschaft, nicht die Menschen!» das Problem von der falschen Seite auf.
Grossveranstaltungen wie die Basler Fasnacht, Konzerte, Demos und ähnliches abzusagen, ist eine Massnahme mit relativ geringen wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen. Klar, einige Kleinbetriebe sind sehr stark abhängig von der Basler Fasnacht zum Beispiel und auch für die Fussballvereine beispielsweise ist das Ausbleiben der Fans ökonomisch nicht einfach abzufedern, aber insgesamt verläuft das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben weiter in den gewohnten Bahnen.
Wenn wir uns jetzt überlegen, dass zusätzlich zu den verordneten Massnahmen auch Arbeitsplätze mit 1’000 und mehr Mitarbeiter*innen durch eine Anordnung des Bundes geschlossen würden, oder der Bund gar den öffentlichen Verkehr zum Erliegen bringen würde, wären die Konsequenzen eben nicht nur für die betroffenen Unternehmen drastisch, sondern in erster Linie für die gesamte Bevölkerung. Mehr noch: Insbesondere die gesellschaftlich Schwächsten und ökonomisch Prekärsten würden unter den unausweichlichen Lieferengpässen bei Lebensmitteln und allen anderen Gütern des täglichen Bedarfs leiden; alle, die kein Auto besitzen, hätten keine Chance mehr auf Mobilität. Aufregung, Panik und Ausfall eines grossen Teils des gesellschaftlichen Lebens (das ja auf der wirtschaftlichen Tätigkeit und sei sie auch kapitalistisch organisiert, basiert), wären die brutale Folge.
Möglicherweise werden weitere, drastischere Massnahmen zukünftig notwendig, das kommt auf den Verlauf der Pandemie an. Bislang aber ist die Risikoabwägung zumindest des Bundes ohne solch gravierende Einschränkungen ausgekommen. Und trotzdem gilt: Jeder verhinderte Kontakt zwischen Menschen hilft potenziell, die Ausbreitung des Virus zu verzögern. Jede Veranstaltung, die nicht stattfindet, hilft potenziell, dass sich das Virus nicht so schnell verbreiten kann und schützt damit diejenigen Menschen, die besonders bedroht sind. Der gesellschaftliche Kampf gegen das Virus ist also ein Stück weit auf die Solidarität der vielen Menschen, bei denen das Virus nicht direkt eine Bedrohung darstellt, mit denjenigen Bevölkerungsteilen, die am Virus zu sterben drohen, angewiesen. Diesem Fakt müssen auch wir uns stellen, oder uns zumindest dazu positionieren, wenn es um Demonstrationen oder ähnliche politische Veranstaltungen geht.
Das soll nicht heissen, dass die von den meisten westeuropäischen Staaten erlassenen Massnahmen einfach technokratisch begründbar wären. Selbstverständlich implizieren sie immer auch politische Entscheidungen. Insbesondere dann, wenn die Massnahmen gegen eine Pandemie auch unsere politischen Grundrechte tangieren, oder wie aktuell in Frankreich auch noch unterstützend dabei helfen, eine soziale Bewegung mundtot zu machen. Gerade wenn Demonstrationen, politische Organisierung und freie Meinungsäusserung verboten werden, ist dies prinzipiell gefährlich. Darob aber die Gefahr des Virus nicht ernstzunehmen, ist fahrlässig. Stattdessen müssen wir vom Bund und den Kantonen fordern, alles zu unternehmen, damit weiterhin unsere Grundrechte gewahrt werden, trotz Corona-Virus.
Denn eigentlich ist es ist die Aufgabe der Behörden in einem Rechtsstaat die Bedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen ihre Grundrechte wahrnehmen können, zum Beispiel mit Demonstrationen. Dies muss insbesondere in Ausnahmesituationen gelten. Denn ansonsten ist die Gefahr gross, dass Willkür (auf der Seite der Behörden) und Burgfrieden (auf der Seite der Bevölkerung) jegliche Form von Kritik unmöglich machen.
Covid-19 und das Gesundheitssystem
Grundsätzlich gilt aber bis hierhin dennoch: Das Virus ist alles andere als harmlos, gerade auf gesellschaftlicher Ebene. In Italien, wo bislang die meisten Fälle in Europa auftraten und schon weit über 100 Menschen gestroben sind, ist das Gesundheitssystem bereits an die Grenzen der Belastbarkeit beansprucht. Die Spitäler sind voll belegt und 10% der am Virus Erkrankten müssen auf der Intensivstation behandelt werden.
Dass das italienische Gesundheitssystem mit einigen tausend Fällen bereits an seine Grenzen stösst, ist ein beunruhigendes Zeichen. Es deutet darauf hin, dass die durch die neoliberale Transformation kaputtgesparten westlichen Gesundheitssysteme nicht mehr in der Lage sind, eine unvorhergesehene Krise bewältigen zu können. Ähnliche Entwicklungen sind auch in Deutschland zu beobachten, wo die Fallzahlen bislang noch weit hinter denen Italiens liegen, aber dennoch bereits medizinisch gesehen der Notstand herrscht.
Dieser oftmals eklatant schlechte Zustand des Gesundheitssystems ist wiederum eine enorme Belastung für alle im Gesundheitswesen Angestellten. Zu geringe Beschäftigungszahlen und miserable Anstellungsbedingungen führen dazu, dass nicht nur keine zusätzlichen personellen Kapazitäten vorhanden sind, um auf die Krise angemessen zu reagieren, sondern dass die Angestellten auch einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Zudem sind in den unterbezahlten Berufen im Gesundheitswesen und in der Pflege zu einem grossen Teil Frauen* beschäftigt, die nicht nur grösstenteils die Sorge- und Pflegearbeit im Krankheitsfall im eigenen Haushalt verrichten müssen, sondern durch die enorme Beanspruchung der Gesundheitsversorgung auch im Beruf einer gewaltigen Belastung ausgesetzt sind.
Das stark am Markt orientierte Gesundheitswesen wurde betreffend Pandemieschutz so lange ausgehöhlt und Kapazitäten abgebaut (wie beispielsweise in den USA geschehen), bis die Pandemie vor der Tür steht und drastische Auswirkungen zu haben drohte. Ausbaden müssen es die Patient*innen und die Angestellten, die im Notstand schlicht nicht mehr genügend Kapazität haben, um eine einwandfreie Betreuung und Behandlung zu gewährleisten. Die massiven Kürzungen im Gesundheitsbereich – auch in der Schweiz – haben zudem fatale Folgen gerade für die Schwächsten in der Gesellschaft. 30 bis 40 Jahre neoliberale Angriffe haben die gesundheitliche Infrastruktur nicht nur geschwächt, sondern auch weniger inklusiv gemacht.
Aber auch im alltäglichen Rahmen führt die Rationalisierung und die Orientierung am Markt zu einer desolaten Situation in den Spitälern: Weil diese wie Unternehmen geführt werden, wird alles «just in time» gekauft, um Lagerhaltung zu minimieren und um allfällige tiefere Preise später mitzunehmen. Das führt dazu, dass in Krisensituationen entscheidende Gesundheitsprodukte fehlen. Dabei bezieht sich das noch nicht einmal auf teure Medikamente, sondern auf ganz profane Dinge: Wenn Schutzmasken und Desinfektionsmittel fehlen, wie zur Zeit aus verschiedenen Spitälern in Deutschland vermeldet, dann bricht die ganze Gesundheitsversorgung zusammen, das Spital steht mehr oder weniger still.
Wer zahlt die Krise?
Die „Coronavirus-Krise“ zeigt, abgesehen von den staatlichen Massnahmen wie Schulschliessungen oder Versammlungsverboten, bislang sehr deutlich, dass das auf Wachstum und Profit fixierte kapitalistische System weder in der Lage ist den aktuellen ökologischen Bedrohungen noch den Herausforderungen durch das Coronavirus wirklich konsequent zu begegnen. Medikamente werden auch in Zeiten der Pandemie nach den Prinzipien des maximalen Profits produziert und verkauft – Schutzmasken und Desinfektionsmittel werden aktuell zu einem Vielfachen des normalen Preises gehandelt, gerade weil die Nachfrage danach so hoch ist. Das führt dazu, dass die Versorgung mit diesen Produkten nicht mehr gewährleistet ist.
Verschiedene Unternehmen und Sektoren haben weiter bereits klar gemacht, wen sie für die erwarteten Umsatzeinbussen durch das Virus zu zahlen lassen gedenken. Bereits die ersten wirtschaftlichen Auswirkungen in der Tourismusbranche veranlassten Anfang dieser Woche einen Verbandsfunktionär, Kündigungen von zum Beispiel Reinigungspersonal in den Raum zu stellen. Dass die Lohnabhängigen die ersten „Opfer“ der ökonomischen Krise im Zusammenhang mit dem Coronavirus sein werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Die Unternehmen wiederum werden ihre Profite vom Staat absichern lassen. Bereits jetzt mehren sich in der Schweiz die Rufe von Unternehmen und Verbänden nach staatlichen Unterstützungsmassnahmen. Selbst die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran schlägt vor, dass man Unternehmen, die im Tourismus oder in der Kultur tätig sind und einen Schaden erlitten haben, mit Bundesgeldern unterstützen soll. Hotelleriesuisse-Zürich macht seine Mitglieder bereits auf die Möglichkeit aufmerksam, dass man Kurzarbeit anmelden könne. Kurzarbeit wird das Instrument der ersten Phase einer wirtschaftlichen Abschwächung sein. Es ist verbunden mit Einkommenseinbussen auf Seiten der Lohnabhängigen. Und da in der heutigen Zeit viele Lohnabhängige einen befristeten Arbeitsvertrag erhalten (d.h. es ist keine Kündigung auf das Auslaufdatum erforderlich), werden bei Kurzarbeit eine nicht unbeträchtliche Anzahl Lohnabhängige ohne Lohnzahlungen dastehen.
Diese Abwälzungen der Kosten auf die Lohnabhängigen müssen wiederum vor dem Hintergrund von jahrzehntelangen Angriffen auf die mageren Errungenschaften der Arbeiter*innenbewegung und der systematischen Ausgrenzung und massiven finanziellen Schlechterstellung der von Armut, Arbeitslosigkeit und Krankheit betroffenen Lohnabhängigen gesehen werden.
Die Pandemie und der Rassismus
Und dann muss schon auch noch erwähnt werden, dass die rassistische Konnotation, mit der der in China ausgebrochenen Erkrankung gerade zu Beginn begegnet wurde, mit aller Deutlichkeit zu verurteilen ist. Die rassistische Stimmungsmache und die psychischen und physischen Übergriffe im Rahmen der Corona-Pandemie haben einmal mehr gezeigt, wie die jahrelange rechte Hetze gesellschaftlich Spuren hinterlasst und die Solidarität erodiert.
Ausserdem wird das Virus die Menschen global gesehen mit ziemlicher Sicherheit auch ungleich treffen. Die relativ hohe Hospitalisierungsrate inklusive Aufenthalt in Intensivstationen macht deutlich, dass das Coronavirus vor allem in „strukturschwachen“ Ländern und Regionen, in denen der Gesundheitszustand der Bevölkerung und vor allem das Gesundheitswesen selbst schlechter sind, verheerende Folgen haben wird. Um so entschlossener müssen Aktivist*innen, die in reicheren Ländern wohnen, sich solidarisch zeigen und dafür kämpfen, dass medizinische Hilfe allerart (Geräte, künftige Medikamente und Impfstoffe) kostenlos und effizient allen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Die Frage, ob das Gesundheitswesen als immerhin zweitgrösster Wirtschaftszweig der Welt ein Bereichungsfeld für die Pharmaindustrie bleibt, oder aber das Recht auf medizinische Versorgung für alle gewährleisten soll, stellt sich somit erneut mit aller Deutlichkeit.
Die aktuelle, ernstzunehmende Krise rund um das Corona-Virus zeigt einmal mehr, wie viele Mittel eigentlich mobilisiert werden könnten, zur Bekämpfung von Hunger, Kriegen und Krankheiten. Es zeigt einmal mehr, dass nicht die Mittel und die materielle Grundlage fehlen, um überall auf der Welt eine medizinische Grundversorgung und genügend Lebensmittel bereitzustellen, sondern es schlicht der Wille ist.
Eine Pandemie verhält sich schlussendlich nach eigenen, für uns sehr schwer abzuschätzenden Gesetzen und Dynamiken. Das macht eine Antwort und angemessene Reaktion darauf zu finden so schwer. Wir müssen aber weder genervt sein ab der angeblichen „Panik“, noch im Virus das nonplusultra alles Schlimmen erkennen. Wir sollten besorgt sein ab den Konsequenzen der Erkrankungen und müssen uns den damit verbundenen Herausforderungen stellen. Zugleich werden wir darob aber nicht aufhören uns auch gegen die aktuelle Asylpolitik an den Grenzen der EU, gegen Gewalt an Frauen*, gegen Armut und Ungerechtigkeit und gegen all das andere Leid auf der Welt einzusetzen.

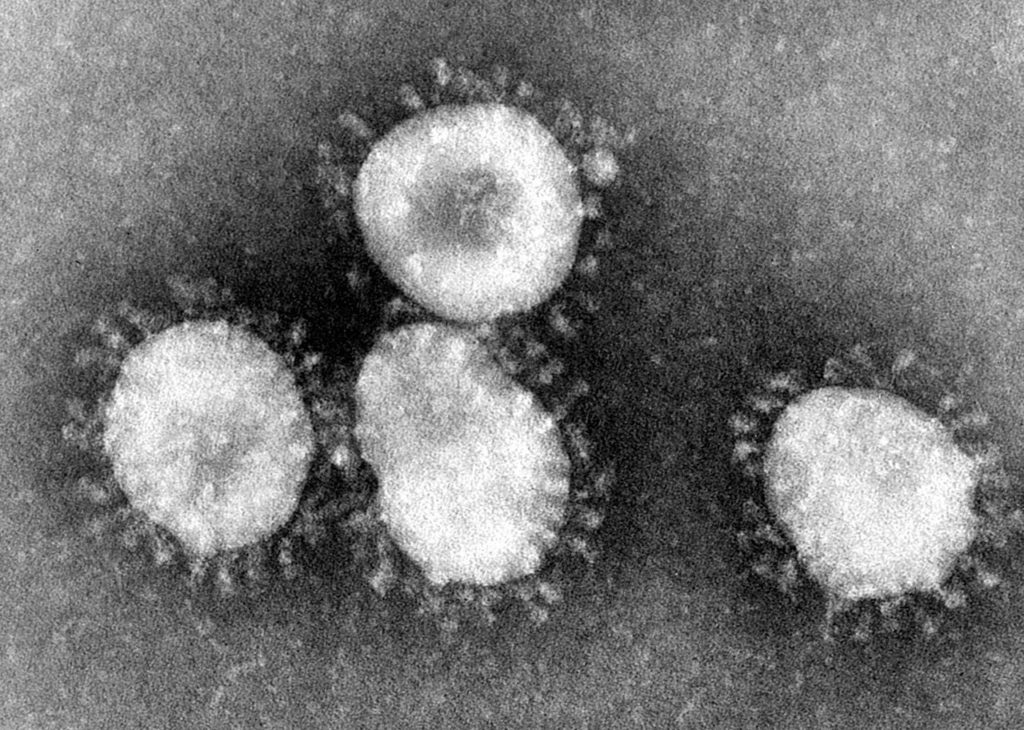



Pingback:Am Rande vermerkt: Wer soll das bezahlen? ‹ BFS: Sozialismus neu denken – Kapitalismus überwinden!