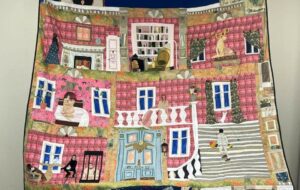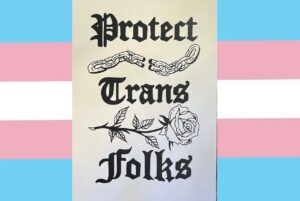Im ersten Teil des Artikels ging es darum, wie Care-Arbeit ungleich verteilt ist und hauptsächlich von FLINT-Personen verrichtet wird. Im zweiten Teil geht es um eine praktische Tipps und Anregungen, wie auch Männer* lernen könnten, sorgender mit ihren Mitmenschen umzugehen. (Red.)
von Marco Fischer (BFS Zürich)
¨Was meine ich mit Care-Arbeit?
Es werden Diskussionen geführt, was alles zu den Begriffen Reproduktions- / Care- / Sorge- oder auch zu emotionaler Arbeit gezählt wird, wie sich diese voneinander unterscheiden oder, ob wir überhaupt von „Arbeit“ sprechen sollten. Auch wenn solche Diskussionen theoretisch interessant sind, lenken sie zu oft von der eigentlichen Frage ab, wie wir die Missstände in der Verteilung von Care-Arbeit (oder Tätigkeit/Verantwortung) im Privatleben zumindest teilweise beheben können.
Ich möchte daher folgend einige Aspekte nennen, die mir wichtig erscheinen, ohne sie dabei als abschliessend oder umfassend zu behaupten. Grundsätzlich zähle ich zu Care-Arbeit das Überlegen und Machen von Handlungen, die das Wohlbefinden von nahen Leuten steigern. Überlegen heisst, dass viel Care-Arbeit gar nicht im direkten Kontakt mit der empfangenden Person passiert, sondern eher im Sinne von Mental Load (dem Überlegen wie eine Person unterstütz werden soll, wie alles geplant und koordiniert werden soll). Natürlich zählen Kochen, Reinigen, Kindererziehen etc. auch zur Reproduktionsarbeit, aber ich möchte mich im folgenden Text auf die emotional-beziehungstechnischen Teile der Care-Arbeit fokussieren, da diese Arbeit oft nicht als solche wahrgenommen und somit unsichtbar gemacht wird (das geht schwieriger beim Kochen, wenn das Essen vor einem steht).
Konkrete Ansatzpunkte zur Anwendung emotional-beziehungstechnischer Care Arbeit sind unter anderem:
Deep Talk:
Deep Talk heisst, einer anderen Person zuzuhören, ihr beistehen, ihr Nähe zeigen, sie weinen lassen, sie spiegeln, sie validieren, nachfragen, bei ihr nachhaken, mit ihr mitdenken, ihr Lösungen vorschlagen, sie trösten, sie konfrontieren usw. Dudes, die sagen: „fühlsch-mi-gspürsch-mi bringts nöd“ realisieren zu oft nicht, wie wohltuend und stärkend nur schon Verständnis sein kann, auch wenn noch keine direkten Lösungen präsentiert werden. Gleichzeitig halten es viele Männer* aber für selbstverständlich, dass ihre Gefühle ernstgenommen werden und bestätigt werden, ja dass sogar ihr oft impulsiver Umgang mit den eigenen Emotionen nicht hinterfragt, sondern akzeptiert wird. Umgekehrt machen sie dies für andere Personen viel seltener. Dabei ist Deep Talk ein unabdingbarer Teil der Care-Arbeit und (über)lebenswichtig, auch wenn er gesellschaftlich zu wenig Anerkennung erhält.
Small Talk/Auf-dem-Laufenden-Sein:
Mir fällt auf, dass im Schnitt FLINT Personen mehr nachfragen, wie es geht und daher besser Bescheid wissen, was gerade die Themen und Schwierigkeiten sind, welche die Leute in einer Gruppe beschäftigen. Hier zeigt sich, dass Small Talk oft mehr ist als nur Small Talk. Man will die kommunikativen Kanäle offenhalten, was eine wichtige Voraussetzung dafür bietet, Veränderungen wahrzunehmen und letztlich eine Grundlage für Deep-Talk ist. Oft begreifen Typen meiner Meinung nach nicht, wie einseitig dieses Aufeinander-Zugehen bleibt, wenn sie sich selbst nicht auch nach anderen erkundigen.

Kollektives Besprechen von Situationen:
Wenn ich in Runden mit überwiegend FLINT Personen sitze, fällt mir immer wieder auf, dass sich der Inhalt der Gespräche sehr oft um das persönliche Befinden der Anwesenden dreht, aber oft auch von Personen handelt, die nicht anwesend sind. Es wird besprochen, wie eine Situation gemeistert werden kann. Damit werden zwischenmenschliche Schwierigkeiten kollektiv diskutiert und oft wird damit gerade mehrfach Care-Arbeit für die Person(en) geleistet, die das Gespräch betrifft. Da oft mehrere Meinungen eingebracht werden, kann der Problemlösungsprozess als relativ demokratisch bezeichnet werden. Wir Cis-Männer* wurden hingegen allzu oft zu Arroganz und Selbstüberhöhung erzogen und dazu angehalten, ihre die Probleme im zwischenmenschlichen Bereich alleine lösen zu können (und zu müssen). Weil wir persönliche Probleme nicht mit andern besprechen, ist uns aber auch oft nicht bewusst, wieviel Care-Arbeit für uns geleistet wird, indem FLINT Personen hinter unserem Rücken mit andern über uns sprechen.
Ansprechen von Unstimmigkeiten:
Häufig kommt es vor, dass Typen nach einem Streit mit einer FLINT Person beim nächsten Wiedersehen emotional und inhaltlich noch am gleichen Punkt sind, wie am Ende des Streits. Männer*n fällt es schwer, „die eigenen Emotionen zu formulieren und zu zeigen und die Emotionen des Gegenübers wahr- und ernstzunehmen. Sowie wieder darauf Bezug zu nehmen und nach den Emotionen zu fragen und Strukturen und Probleme in der Beziehung oder in Gruppenkonstellationen wahrzunehmen und anzusprechen und sich der Auseinandersetzung zu stellen.“ ( Zitat aus dem Text: Können wir über etwas anderes Reden) FLINT Personen haben meist in der Zwischenzeit bereits mit mehreren Leuten darüber gesprochen, sich Lösungsansätze ausgedacht und die eigenen Emotionen einigermassen verarbeitet. Somit haben die FLINT Person schon einen grossen Teil der nötigen Beziehungsarbeit im Vorhinein gemacht. Viele FLINT Personen machen so die mühsame Erfahrung, dass es dann an ihnen liegt, (problematische) Strukturen und Verhaltensweisen in Beziehungen anzusprechen, weil sich sonst ja nichts ändert und Probleme nicht gelöst würden. Logischerweise ist dies ultra ermüdend.
Awareness für Gruppendynamiken:
Wichtige Anteile der emotionalen Care-Arbeit sind die Empathie und das Mitdenken für andere. Wir Männer* beschäftigen uns an Sitzungen damit, was wir als Nächstes inhaltlich Wertvolles sagen (und wie wir uns damit oft selbstdarstellen) können. Damit beschäftigen sich FLINT Personen auch. Gleichzeitig scannen sie jedoch immer wieder die Runde mit der Frage im Hinterkopf: „Wie fühlen sich die Leute? Was könnte ich machen, dass sich alle wohl fühlen? Wie kann ich meinen nächsten Punkt formulieren, sodass er die andere Person nicht verletzt? Gibt es Leute, die nicht genügend Raum zum Sprechen bekommen? Wie kann ich in Bezug auf bisher Gesagtes nehmen und Gedanken verknüpfen“. Es braucht also mehrfache Hirnkapazität, um sich inhaltliche Diskussionspunkte zu überlegen und gleichzeitig die Gruppendynamik einzubeziehen. Auch wenn einige Typen sich auch Mühe geben, nicht zu viel Raum einzunehmen, scheitern sie in der Gesamtheit immer noch allzu oft; wohl auch weil es keine gemeinsame Reflexion darüber gibt. Darum gehe ich gehe davon aus, dass sich exklusive FLINT-Räume nicht nur besser anfühlen, weil keine Typen dabei sind, die zu viel Platz einnehmen (auch in FLINT Räumen gibt es Menschen, die eine dominante Position einnehmen wollen und viel Platz einnehmen) und Erfahrungen nicht erklärt werden müssen, sondern auch weil es schlicht viel mehr Menschen im Raum hat, die Sorgearbeit leisten und Wert auf die aktuelle Befindlichkeit aller Anwesenden legen.
Gesten der Nettigkeit:
Gerade in klassischen Kernfamilien sind es zumeist Mütter, die verantwortlich dafür sind (resp. verantwortlich gemacht werden), soziale Beziehungen zu pflegen, indem beispielsweise Geschenke gemacht werden, Treffen geplant werden, bei Leuten denen es nicht gut geht, vorbeigeschaut/nachgefragt wird etc. (Stichwort Mental Load). Care-Arbeit drückt sich nicht nur durch Gespräche aus, sondern auch durch Gesten, die anderen Menschen eine Freude machen, ihnen das Gefühl gegeben wird, dass an sie gedacht wird, dass sie gemocht werden. Ich beobachte auch in unseren Freund*innenkreisen, dass eher FLINT-Personen einmal nachfragen, Geschenke machen, ernstgemeinte Komplimente aussprechen etc.

Was heisst das jetzt für uns? Ein paar Handlungsvorschläge
Care-Arbeit aufwerten:
Zunächst finde ich es wichtig, die für Menschen überlebenswichtige Rolle und Zentralität der (emotionalen) Care-Arbeit als solche zu sehen und anzuerkennen. Denn die Auseinandersetzung mit zwischenmenschlichen Beziehungen ist absolut politisch! Das „Private“ ist politisch!
Gerade in unserem aktivistischen Kontext beschränken sich Beziehungen zwischen Genoss:innen oft nicht nur auf die gemeinsame politische Arbeit, sondern sind auch Freund:innenschaften, Mitbewohner:innenschaften, romantische +/- sexuelle Beziehungen etc. Und das ist auch gut so. Daraus ergeben sich logischerweise komplizierte Beziehungskonstellationen, aber diese halten uns auch zusammen.
Bilden von Care-Arbeit-Kompetenzen:
FLINT Personen haben durch ihre Sozialisierung einen gewaltigen Kompetenzvorsprung, wenn es um Care-Arbeit geht. Da ihnen konstant auch die Aufgabe aufgebürdet wird, den grössten Teil und den ersten Schritt im sozialen Umgang zu leisten, trainieren sie konstant diese Kompetenzen. Damit aber mehr Care-Arbeit auf unsere Schultern als Männer* umverteilt werden kann, ist es fundamental, dass wir uns bilden.
Dazu gibt es natürlich unzählige Wege und Ressourcen, die gelesen werden können. Eine grosse Liste mit guten Broschüren zu Awareness, Privilegien, sexualisierter Gewalt, psychischer Varianz, Rassismus, transformativer Gerechtigkeit usw. findet sich hier.
Privilegien hinterfragen:
Das Hinterfragen von unseren Privilegien dient meiner Meinung nach in erster Linie dazu, unsere Empathie zu stärken, indem Verständnis für Menschen geschaffen wird, welche diese Privilegien nicht haben. Weiter geht es um das Ableiten von politischen Forderungen, die das Ziel haben, die Privilegien durch strukturelle Veränderungen für alle zugänglich zu machen (und damit möglichst abzuschaffen). Die meisten Privilegien sind aber so strukturell in der Gesellschaft verankert, dass sie nicht durch blosses Reflektieren verschwinden. Eine nicht abschliessende Liste mit Cis-Männlichen-Privilegien findet sich hier. Hilfreich kann es sein, solche Privilegienlisten auch kollektiv zu besprechen.
Eine weitere Form, Empathie zu stärken, ist es, Bücher/Filme/Musik/Kunst, die aus der Perspektive weiblicher, queerer wie auch rassifizierter Personen gemacht wurden, zu konsumieren und zu versuchen, uns in die dargestellten Zusammenhänge einzufühlen.
(kritische) Männer*runden:
Ich empfinde Männer*runden zu kritischer Männlichkeit als sinnvolles Mittel, um beispielsweise Privilegien und die Sozialisierung zu reflektieren. Wichtig fände ich es aber auch, dort über Care-Arbeit zu sprechen, uns gegenseitig zu bilden oder auch zu besprechen, was uns gerade so schwer fällt, wenn es um das Leisten von Care-Arbeit oder um Forderungen, die FLINT-Personen von uns politisch an uns herantragen, geht. Auch sollten sie ein Ort sein, an dem Care-Arbeit unter Männer*n etabliert wird. Erfahrungen mit kritischen Männer*gruppen haben aber gezeigt, dass solche Runden auch das Risiko bergen, dass sich Männer* gegenseitig in Schutz nehmen und sexistisches Verhalten legitimieren oder decken. Deshalb sollten diese Diskussionen im engen Austausch und optimalerweise im Beisein von FLINT Personen geschehen
Anpassen des Sprechverhaltens in Gruppen:
Um Verantwortung für das Wohlbefinden und die Teilhabe aller Anwesenden in Gruppen/Sitzungen zu übernehmen, ist es wichtig, dass wir unser Sprechverhalten und Auftreten reflektieren und verbessern. Im Text „Wie diskutieren? – Herrschaftsverhältnisse auf Diskussionsveranstaltungen“ wird von Lauten und Leisen Praktiken geschrieben:
Laute Praktiken: Unter „lauten Praktiken“ verstehen wir Handlungen durch die andere Menschen – zumeist Frauen oder andere nicht männliche Geschlechter – angegriffen und in ihren Freiräumen begrenzt werden. Beim Sprechen anderer Teilnehmer_innen gehört dazu vor allem das Unterbrechen oder Disqualifizieren von Redebeiträgen durch Kommentare, Grinsen, Augenverdrehen und ähnliches. Beim eigenen Sprechen gehört dazu vor allem, das explizite Beleidigen oder Herabsetzen anderer. Sexismen und Ironie sind dabei Mittel, die „Lacher“ auf der eigenen Seite zu haben. Mit aggressiven Ton werden unliebsame Stimmen zum Schweigen gebracht und darüber hinaus Räume für diejenigen geschlossen, die nicht die Souveränität besitzen, dem selbstbewusst entgegen zu treten.
Leise Praktiken: Unter „leisen Praktiken“ verstehen wir eine Art des Sprechens, die andere nicht direkt angreift und einschränkt, aber der eigenen männlichen Selbstdarstellung dient. Diese Praktiken sind anders als „laute Praktiken“ schwieriger zu fassen und explizit zu machen – sie bilden daher das bevorzugte Mittle zur Demonstration männlicher Dominanz. Rein formell gehört zu diesem Stil der dozierende Ton und die ausufernde Länge. Diese selbstbewusste Art sich Raum zu nehmen, zeichnet sich zumeist durch die Unfähigkeit aus, Stimmungen im Raum wahrzunehmen und anderen Teilnehmer_innen Platz für ihre Beiträge einzuräumen. Eigene Interessen werden hier unreflektiert und unsensibel vor diejenigen anderer gestellt. Inhaltlich zeichnen sich solche Beiträge meist dadurch aus, dass in ihnen immer wieder Sätze auftauchen, die die eigene Kompetenz demonstrieren sollen („Wie in aktuellen Debatten ja betont wird…“, Wie es bei Marx ja schon heißt…“ etc.).
(kollektiver) Umgang mit psychischen Belastungen:
In Anbetracht der aktuellen Krise und der zunehmenden psychischer Belastung vieler Personen, sehe ich es als besonders wichtig, uns zu überlegen, wie wir Menschen in Krisensituationen (bspw. Depressionen) kollektiv unterstützen können. Damit soll verhindert werden, dass nicht wie so oft die FLINT Personen, die ihnen nahestehen, die Verantwortung schultern, weil es sonst keiner täte. Das Bilden von Care-Kollektiven sehe ich da als einen sinnvollen Weg. Eine gute Anleitung dazu findet sich hier.
Unterstützen von Betroffenen von sexualisierter Gewalt:
Sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen werden in unserer patriarchalen, auf Rape- Culture basierenden Gesellschaft generell totgeschweigen, obwohl sie überall und andauernd vorkommen (Stichwort Silencing!). So werden betroffene Personen alleingelassen. Wenn sie sich doch Personen anvertrauen, dann bevorzugen sie zumeist FLINT-Personen. Viele dieser Zuhörer:innen haben dabei bereits selbst Gewalt erlebt. Sie können dadurch zwar mehr Verständnis aufbringen, werden dadurch aber allzu oft auch selber an eigene schmerzliche Erfahrungen erinnert und allenfalls sekundär traumatisiert. Ich vermute, dass diese Bevorzugung respektive einseitige Inanspruchnahme vor allem damit zu tun hat, dass Cis-Männern* nicht zugetraut wird, angemessen unterstützend reagieren zu können (was natürlich auch viel zu oft stimmt) und Männer* sich auch nicht getrauen, das Thema anzusprechen. Wenn wir aktiv gegen sexualisierte Gewalt kämpfen wollen, müssen wir nicht nur selbst damit aufhören, übergriffig zu sein und bei übergriffigem Verhalten anderer Männer* wegzuschauen, sondern auch uns im Thema Rape-Culture bilden und lernen, brauchbare Unterstützer für Betroffene zu sein. Dies beinhaltet ein aktives, aber einfühlsames Ansprechen und Nachfragen bezüglich sexueller Gewalt, Eingehen auf die Bedürfnisse der Betroffenen Person, absolutes Ernstnehmen der Perspektive der Betroffenen Person, keine Schuldzuweisungen an die betroffene Person. Ein Indiz, dass eine FLINT Person sexuelle Gewalt erlebt hat, ist, wenn sie sagt, der Sex sei nicht so gut gewesen. Viel zu oft bedeutet für FLINT Personen schlechter Sex, dass sie Übergriffe erlebt haben, sie Schmerzen hatten, während für Cis-Dudes schlechter Sex eher an die eigene Performance gekoppelt ist („ihn nicht hochbekommen, zu früh gekommen“). Eine Broschüre mit vielen wertvollen Tipps findet sich hier.
Eine Auseinandersetzung soll auch beinhalten, sich einzugestehen, möglicherweise selbst von sexueller Gewalt betroffen zu sein. Gerade in der Schwulen Community wird dieses Thema totgeschwiegen, obwohl viele schon Vergewaltigungen erlebt haben.
Unsicherheiten zugeben, bei FLINT Personen nachfragen:
Wie oben bereits geschrieben, tendieren Typen dazu, alles alleine lernen und leisten zu wollen. Dazu kommt die toxisch-männliche Unfähigkeit, Unsicherheiten und Unwissen zuzugeben. FLINT-Personen besprechen viel öfter gemeinsam, wenn sie sich in Situationen unsicher fühlen. Ich glaube, dass, wenn wir aktiv FLINT-Personen im Erlernen von Care-Arbeit um Hilfe bitten, viele bereit sind, zu beraten und Dinge gemeinsam zu besprechen. Eine Art zu fragen, könnte sein: „Hey ich weiss gerade nicht wie ich in dieser Situation reagieren soll… wie ich Thema YX- mit Person-XY ansprechen soll… – nicht wie ich Person XY unterstützen kann…“. Wichtig dabei ist zu fragen, ob die FLINT Person gerade Lust und Kapazitäten dazu hat, sowohl diese Bildungsarbeit auch als Teile dieser Care-Arbeit anzuerkennen und zu schätzen. Natürlich macht es auch Sinn, zuerst anderen Typen diese Fragen zu stellen.
Lass uns Care-Worken. Aber wie starten?:
Auch wenn ich einer theoretischen Bildung wie der oben beschriebenen grosse Wichtigkeit beimesse, finde ich, wir sollten nicht zuerst 100 Bücher gelesen haben, bevor wir in Aktion treten können. Auch sollen uns (berechtigte) Unsicherheiten im Leisten von Care-Arbeit nicht davon abhalten, es zu versuchen und dadurch zu lernen.
- Vermehrt persönlichen Smalltalk und Deep-Talk führen und im Alltag einfach mehr fragen: Hey wie geht’s? Was beschäftigt dich gerade? Wie fühlst du dich bei…? Kann ich dich irgendwo unterstützen, falls ja, wie? Wie war die Sitzung für dich? Hier macht es auch Sinn sich nicht direkt mit einem „Schon Ok“ des Gegenübers zufrieden zu geben, sondern nachzuhaken mit „Wie geht es dir wirklich?“ oder spiegeln: „Du wirkst etwas bedrückt, bist du sicher, dass alles ok ist?“. Gute Eisbrecher für Deep Talk sind auch, an frühere Gesprächen anzuknüpfen und zum Beispiel zu fragen: „Wie sich der Konflikt mit XY weitergegangen?“ Wem diese Frage unangenehm ist, weil es irgendwie an der lange ansozialisierten hetero-Maskulinität kratzt, kann einfach ein „Alte/Alti“ anfügen: „Wie fühlsch dich, Alte?“ (Kleiner Scherzo, aber lieber so, als gar nicht fragen)
- Sich in Gruppensituationen vermehrt fragen, wie die Befindlichkeit der Leute ist. Wie geht es den Leuten? Wer hat schon viel, und wer hat überhaupt noch nicht gesprochen? Wie viel habe ich schon gesagt? Geht es mir bei der nächsten Redewendung darum, mich selbst darzustellen, oder (und) ist der Punkt wirklich wichtig für die Diskussion? Bei Unsicherheit können Metadiskussionsfragen wie „Ich bin gerade nicht sicher, ob sich alle Leute wohlfühlen, wie seht ihr das?“ helfen.
- Vermehrt nette Gesten der Aufmerksamkeit leisten, gerade bei Menschen, von denen wir wissen, dass es ihnen nicht gut geht. Sich fragen: „Was mag diese Person? Was tut dieser Person gut?“, ist wohl DIE Grundfrage der Care-Arbeit.
- In Männer*runden vermehrt über zwischenmenschliche Beziehungen sprechen, as simple as that. Fragen dazu: „Wie läufts mit…?“ Wie geht’s eigentlich XY?“ „Wir haben jetzt lang auf politisch-strategischer Ebene über Konflikt XY gesprochen, wie geht es dir emotional damit, nimmt es dich mit?
Sorgende Männer*freundschaften:
Viel zu oft läuft es gerade in heterosexuellen Kontexten so, dass FLINT sich zwar um die emotionalen Probleme ihrer männlichen Partner kümmern, aber nicht umgekehrt. Besagte FLINT Personen kümmern sich aber auch um die emotionalen Belange ihrer weiblichen/queeren Freund*innen und stehen so unter einer Doppelbelastung. Deshalb ist es wichtig, dass wir sorgende Männer*freundschaften entwickeln. Eine Schwierigkeit sehe ich zum einen darin, dass Menschen im Kapitalismus dazu erzogen werden, andere als Konkurrent:innen zu sehen, anstatt als Freund:innen. Zum anderen merke ich persönlich, wie ich mich selbst lieber an FLINT Personen mit persönlichen Belangen wende, weil ich ihnen mehr zutraue und mich besser aufgehoben fühle. Deshalb müssen wir lernen, uns zu trauen, uns vor anderen Typen emotional zu öffnen. Wir können keine bedeutenden Männer*freundschaften entwickeln und auch nicht lernen Care-arbeit für FLINT-Personen zu leisten, wenn wir es selbst nicht schaffen Gefühle, die nicht ins Bild klassischer Männlichkeit passen auch vor anderen Männer*n zuzulassen. Ich meine damit Gefühle wie Unsicherheit, Angst, Traurigkeit die gemeinhin als unmännlich gelten.
Männliche Formen der Care-Arbeit entwickeln und ausbauen:
Care-Arbeit muss nicht immer die oben erwähnten, klassisch weiblich geprägten Formen annehmen. Es kann auch mal zusammen Sport machen, bei einem Thema pragmatisch helfen oder anderes sein. Bei diesen Formen der Care- Arbeit wurde mir von einigen FLINT Personen schon gesagt, dass sie dies bei Typen schätzen und teils bei FLINT Personen eher vermissen. Meine Schlussfolgerung ist daher nicht, dass wir alle männlichen Formen der Care-Arbeit über Bord werfen, sondern im Gegenteil es schaffen sollten, diese auch als das zu bezeichnen und weiterzuentwickeln. Wir müssen uns aber gleichzeitig in Deep Talk etc. üben, sodass wir einer Person beides anbieten können: Sport ohne viel Gespräche, aber halt auch Deep Talk bei Tee! Überlegungen, welche Formen von Care-Arbeit Männer* gut können und ausgebaut werden sollen, könnten bzw. sollten Gegenstand von (kritischen) Männer*runden sein.

Last Words…:
Abschliessend lässt sich sagen, dass solche Bestrebungen in der konstanten inhaltlichen und persönlichen Auseinandersetzung mit Feminist:innen passieren muss. Aufgrund unserer patriarchalen Sozialisierung und der sozialen Umstände werden wir immer wieder Fehler begehen und Konflikte werden zwangsläufig auftreten. Dabei ist es wichtig, FLINT Personen zuzuhören, und von ihrer Kritik zu lernen und sich nicht demotivieren zu lassen. Indem sie mit uns diskutieren und uns belehren, zeigen sie uns, dass sie uns noch nicht komplett aufgegeben haben und wir ihnen die extrem mühsame Bildungsarbeit wert sind. Dies gilt es unserseits wertzuschätzen.
In diesem Sinne, take care 🙂