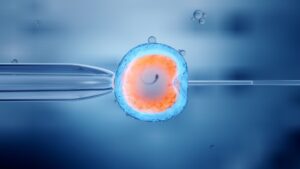Vor 50 Jahren wurde das letzte faschistische Regime Europas gestürzt. Die gängige bürgerliche Erzählung erinnert gerne an die erfolgreiche demokratische Revolution. Tatsächlich tendierte das Bündnis zwischen dem Movimento das Forças Armadas (MFA; linksgerichtete Bewegung innerhalb der Armee) & der Arbeiter:innenklasse zu sozialistischen Idealen, & die Arbeiter:innenklasse entwickelte durch ihre politische Selbstorganisation Ansätze einer Gegenmacht zum sich neu konstituierenden Staat. Diesen Tendenzen nach links wurde aber ein Ende gesetzt, als bürgerlich-gemässigte Mitglieder des MFA die linken Tendenzen im MFA entmachteten & als die erste verfassungsmässige Regierung die Entwicklung der Revolution in bürgerlich-demokratische Bahnen lenkte. Die bürgerliche Ordnung wurde so wiederhergestellt, ganz ohne die Revolution niederzuschlagen. Raquel Varela, Autorin von «A People’s History in the Portuguese Revolution», bietet einen Einblick in die revolutionären Entwicklungen innerhalb der Arbeiter:innenklasse während des Machtvakuums nach dem Sturz des faschistischen Regimes, deren Beziehungen zu den linken Parteien und zur Bourgeoisie. (Red.)
Interview von Esquerda Diário mit Raquel Varela; aus esquerdadiário.com.br
Das Buch von Raquel Varela ist eine hervorragende Darstellung des tiefgreifenden Selbstorganisationsprozesses der Arbeiter:innen und der Bevölkerung, der Infragestellung der kapitalistischen Ordnung und der Politik der „demokratischen Konterrevolution“, die mit der Komplizenschaft von PCP (Kommunistische Partei Portugals) und PS (Sozialdemokratie) umgesetzt wurde, um der letzten grossen sozialen Revolution in Westeuropa ein Ende zu setzen.
Esquerda Diário: Was ist in Portugal nach dem 25. April 1974 passiert?
Varela: 1974 geschah in Portugal etwas Eigenartiges. Ein Staatsstreich öffnete die Tür für eine soziale Revolution. Aber was ist schon eine Revolution? Der Moment in der Geschichte, in dem die Massen die Macht des Staates in Frage stellen. Am Anfang waren es nur die Massen. Dann organisierten sie sich nach und nach bewusst in Arbeiter:innenausschüssen, Nachbarschaftsausschüssen, demokratischen Verwaltungsausschüssen…, die von den politischen Parteien herausgefordert wurden.
Die Sozialistische Partei (Partido Socialista; Sozialdemokratie) gab es damals noch nicht [sie wurde 1973 in Deutschland mithilfe der SPD gegründet; Anm. d. Red.]. Sie entwickelte sich erst im Sommer 1975 von einer kleinen Randgruppe mit ein paar Dutzend Aktivist:innen zu einer Massenpartei mit 80’000 Mitgliedern. Die Kommunistische Partei Portugals (PCP) entwickelte sich von einer Avantgardepartei mit 2’000 bis 3’000 Aktivist:innen im April 1974 innert eines Jahres zu einer Partei mit 100’000 Mitgliedern.
An einem Tag änderte die Geschichte, was sich seit Jahrzehnten nicht geändert hatte. Millionen von Menschen „von unten“ hatten eine direkte Stimme in ihrem Leben. Politik war nicht länger eine Tätigkeit für Expert:innen und Professionelle. Es war förmlich das Gespenst der Selbstbestimmung. Es war die letzte europäische Revolution, die das Privateigentum an den Produktionsmitteln in Frage stellte.
In den Bildern der Nelkenrevolution stehen immer Soldaten und Panzer im Mittelpunkt, aber es wird wenig über diesen Prozess der Selbstorganisation der Arbeiter:innen und der Bevölkerung gesagt. Welche Rolle spielte jeder einzelne dieser Akteure?
Es war zunächst eine demokratische Revolution, die sich dann in eine soziale Revolution verwandelte. Was am 25. April begann, war ein klassischer Staatsstreich, aber es war auch die Keimzelle einer sozialen Revolution, die eine Veränderung der Produktionsverhältnisse herbeiführte, die als politisch-demokratische Revolution begann und das politische Regime veränderte. In wenigen Tagen oder Wochen war die Ablösung des politischen Regimes der Diktatur durch ein demokratisches Regime praktisch garantiert. Doch es waren auch die Grundlagen für eine weitere Revolution gelegt, die für die soziale Gleichheit kämpfte.
Diese Grundlagen wurden von einem sozialen Subjekt geschaffen, das sich hinter der Armee (und daher ohne Furcht) in die Geschichte einschaltete: die Arbeiter:innenklasse und die Bevölkerung und die Studierenden. Schnell übernahm es die Führungsrolle gegenüber der Armee und wurde so zum Anführer der Revolution und überliess der Bewegung der Streitkräfte (MFA) die Aufgabe, einen Staat wieder aufzubauen, der auch schon 1926 durch einen solchen [militärischen; Anm. d. Red.] Putsch in eine Krise geraten war.
Das „Volks-MFA-Bündnis“ (aliança povo-MFA oder Aliança Povo/MFA) war ein bevölkerungsnahes politisches Projekt, das in seinen Anfängen von der PCP und vom PS unterstützt wurde und die Bevölkerung unter die Führung der MFA stellte. Eine Linie, die der Politik des „nationalen Wiederaufbaus“ zwischen 1945 und 1947 gemäss des PCF in Frankreich sehr ähnlich war, die ich auch in meinem Buch über die Geschichte der PCP in der Revolution behandle. Vor diesem Hintergrund begann sich eine Parallelität oder Zweiteilung der Machtorganisationen herauszubilden: Die MFA spaltete sich ab und ein Teil von ihr schloss sich der „Bevölkerungsmacht“ (poder popular) an, die sich als Arbeiter:innenklasse in Arbeiter:innenkomitees, Nachbarschaftskomitees und später auch Soldatenkomitees selbst organsierte und konstituierte.

Die Nelkenrevolution war eine der wichtigsten Revolutionen des gesamten 20. Jahrhunderts, in der sich starke Doppelmachtstrukturen herausgebildet hatten. Was die Ausweitung dieser Parallelmacht gegenüber dem Staat anbelangt, wies dieser historische Prozess viele Ähnlichkeiten mit der italienischen Revolution von 1919-1920 (bienio rosso), der ungarischen Revolution von 1956 und der chilenischen Revolution auf.
Es war auch, und das ist ein weiteres wichtiges Merkmal, eine Revolution in der Metropole [in Portugal als dem entwickelten Zentrum des portugiesischen Kolonialreichs mit den entsprechenden Abhängigkeits- und Ausbeutungsbeziehungen zur kolonialen Peripherie; Anm. d. Red.], die aufgrund der antikolonialen Revolutionen (Kolonialkrieg) in den portugiesischen Kolonien stattfand.
Es kam zu Streiks, Fabrikbesetzungen… Könntest du mehr über die Teilnahme der Arbeiter:innenklasse am ganzen Prozess sagen?
Die meisten sozialen Konflikte der portugiesischen Revolution wurden von den Arbeiter:innen ausgetragen, insbesondere in den grossen Industriegürteln von Porto, Setúbal und Lissabon; allen voran aber in Lissabon, wo 43 % der Arbeitskämpfe stattfanden. Die Streiks fanden also im Sektor der direkten Wertschöpfung statt. Zudem wurden sie von einer relativ jungen Arbeiter:innenklasse geführt (die grosse Abwanderung vom Land in die Stadt fand Anfang der 1960er Jahre statt) und sie waren geografisch sehr konzentriert.
Die „reformistische“ Politik im klassischen Sinne, wie Verstaatlichungen, Landreformen oder Lohnverbesserungen, erhielt eine revolutionäre Dimension, indem sie mit den Methoden der Arbeiter:innenbewegung (Streiks, Land- und Fabrikbesetzungen) und in vielen Fällen durch autonome Organisationsstrukturen von Arbeiter:innen, Landarbeiter:innen und zeitweise auch Soldaten durchgesetzt wurde.
Wie haben die Arbeiter:innenausschüsse funktioniert?
Am 25. und 26. April gingen die Leute zu ihren Arbeitsplätzen, um an den Geschehnissen teilzuhaben. Aber niemand wusste genau, worum es ging. Doch sie hofften auf das Ende der Diktatur, was Grund genug war, das Haus zu verlassen. Als die Leute an ihren Arbeitsplätzen ankamen, versammelten sie sich in Hunderten von Fällen und begannen, über Politik zu diskutieren, und das in einem Land, in dem die Devise gelautet hatte: „Man spricht weder über Politik noch über Religion.„
Doch wer waren diese Menschen? Industrie- und Dienstleistungsarbeiter:innen und Student:innen. Und worüber sprachen sie? Zum einen vor allem von der „Unterstützung der Junta de Salvação Nacional und des MFA [Erstere war eine Gruppe von Offizieren, die die staatliche Ordnung nach dem Regimesturz übergangsweise aufrechterhielt; Anm. d. Red.], um den Faschismus zu zerschlagen“. Zweitens kamen nach und nach Forderungen der sozialen Gruppen auf, die sie vertraten. Die Organisierung war aus der Not gewachsen, es gab keine festgelegten Wortführer:innen, ausser in den grossen Industrie- und Kommunikationsunternehmen, in denen es bereits Betriebsausschüsse gab, die in vielen Fällen schnell im Plenum zu arbeiten begannen.

Das erste Thema war dabei selbstverständlich der Kampf um die Freiheit. Wie viele Revolutionen in der Geschichte wurden nicht nur durch soziale Ungleichheit und Krieg ausgelöst, sondern eben auch durch diktatorische Regime?
Doch die Arbeiter:innen, die an ihren Arbeitsplätzen gegangen waren, um sich am Sturz des Regimes zu beteiligen, begannen dennoch rasch damit, soziale Forderungen auf den Tisch zu legen. Denn der Kern des Regimes – ob Diktatur oder Demokratie – war der Konflikt des Systems: Kapitalismus oder soziale Gleichheit.
Die von der Salazar-Diktatur ererbten politischen und gewerkschaftlichen Strukturen Portugals führten dazu, dass zum Zeitpunkt des Staatsstreichs der grösste Teil der Arbeiter:innen und der Mittelschicht keiner politischen Organisation angehörte; die faschistischen Gewerkschaften waren völlig diskreditiert.
Die Streiks von 1968-1970 und 1973 hatten nicht zum Sturz des Regimes geführt. Es hatte sich um Streikwellen gehandelt, die denen von 1969 oder 1962 ähnelten. Qualitativ entscheidend war jedoch der Militärputsch von 1974 unter Führung des MFA.
Die nationalen Gewerkschaften, die von der Regierung kontrolliert wurden, waren als Strukturen für die Kontrolle der Arbeiter:innenbewegung in Misskredit geraten, und die Intersindical, eine 1970 geschaffene alternative Struktur, die von progressiven Katholik:innen und der PCP geführt wurde ( wobei nicht klar ist, welcher dieser beiden Flügel bis 1974 mehr Gewicht in dieser Struktur hatte), hatte am 25. April gerade einmal in 12 Gewerkschaften Einfluss.
Von den 158 Unternehmen, in denen es zwischen dem 25. April 1974 und dem 1. Juni 1974 zu Arbeitskämpfen kam, war das Verhandlungsorgan in 61 Fällen ein Arbeiter:innenausschuss, in sechs Fällen der Betriebsrat und in zehn Fällen die nationale oder Bezirksgewerkschaft.[1]
Erst während der Revolution und aufgrund der Revolution wurde die Intersindical zur führenden Struktur der organisierten Arbeiter:innenbewegung, allerdings in einem langen Prozess, der sich über die gesamte Revolution hinzog und der in einem sehr angespannten Dialog mit den Arbeiter:innenausschüssen stattfand.
Die Arbeiter:innenausschüsse, eine „rätedemokratische“ Organisationsform, traten in fast allen Fabriken und Dienststellen des Landes auf, wurden in Arbeiter:innenversammlungen gewählt und sollten nach dem Prinzip der allgemeinen Abberufbarkeit funktionieren.
Dieser Umstand darf nicht ausser Acht gelassen werden, wenn man verstehen will, wie sehr das Privateigentum in diesem Teil Europas in Frage gestellt wurde. Diese, und nicht die Gewerkschaftsführungen, waren die Ursache für die meisten Arbeitskämpfe zu Beginn der portugiesischen Revolution, führten einige der wichtigsten Konflikte an. Dadurch erregten sie den Widerstand der PCP und der Mehrheit der Gewerkschaftsführungen, die die Arbeiter:innenausschüsse als „Wilde Organisationsformen, Instrumente des Klientelismus und der Spaltung“ betrachteten.
Es entstanden auch andere Formen der Selbstorganisation der Bevölkerung, wie Nachbarschaftskomitees und Soldatenkomitees. Welche Merkmale wiesen diese auf?
Die Nachbarschaftsausschüsse waren echte „lokale Entscheidungsorgane“. Sie entstanden fast sofort als lokale Entscheidungsstrukturen und fungierten als Parallelorgan zu den Gemeindeverwaltungen, die sich gerade wiederaufbauten. Die Gemeindeverwaltungen dienten letztendlich auch eher als Personal- und Finanzierungsquelle für die grossen Parteien (insbesondere für den PS und die PCP) denn als lokale Verwaltungsorgane. Die Verwaltungsaufgaben wurden von den Nachbarschaftsausschüssen übernommen, die praktisch direkt mit der Zentralgewalt und dem MFA verbunden waren. Die Formen der Koordinierung der Nachbarschaftsausschüsse waren unterschiedlich, aber sie waren die erste Stelle, an der sich die Gegenmacht in dieser Doppelherrschaftssituation koordinierte, noch vor den Arbeiter:innenausschüssen.Mário Tomé von der Militärpolizei erinnert daran, dass die Soldatenausschüsse erst nach der Spaltung des MFA im August und September 1975 entstanden und dass sie auch Einfluss auf den gesamten Prozess hatten: „Die Soldatenausschüsse waren der revolutionäre Kern innerhalb der Truppen, auch innerhalb der linken Truppen.“ Diese Doppelmachtsituation [revolutionäre linke Soldatenausschüsse und die Oberbefehlsgewalt; Anm. d. Red.], die das Wesen eines Demokratisierungsprozesses in einer zentralistischen Staatsstruktur ausmacht, wurde von einigen Dutzend MFA-Offizieren unterstützt, die beim Staatsstreich vom 25. November 1975 verhaftet wurden.
Der heisse Sommer 1975 (crise de 25 de novembro de 1975)
Nach dem Sturz des faschistischen Estado Novo am 25. April 1974 kam es in der Übergangsphase zu heftigen Spannungen mit der 6. Provisorischen Regierung. Grund waren zum einen wirtschaftliche Probleme in der unmittelbaren Übergangszeit. Nachdem das Arbeitsministerium die sektorbezogenen Forderungen von zehntausenden Bauarbeiter:innen nicht erfüllen wollte, die in Lissabon vom 12. November 1975 weg zwei Tage lang den Tagungsort der verfassungsgebenden Versammlung bestreikt hatten, radikalisierten sich die Bauarbeiter:innen aber auch politisch. Sie wandten sich grundsätzlich gegen die 6. Übergangsregierung und zwangen sie zur vorübergehenden Suspendierung. Hierauf setzte eine Militärbewegung ein, um die allgemein fragile Autorität der jungen repräsentativen Demokratie zu stabilisieren; mit Sympathien der Bäuer:innen im Norden des Landes.
Auch der MFA war über die Ziele der Nelkenrevolution gespalten. Auf der einen Seite suchte die bürgerlich-gemässigte Gruppe der Neun innerhalb des MFA (grupo dos nove) den Schulterschluss mit den Sozialdemokraten (PS) und der politischen Rechten, und auf der anderen Seite bildete sich eine zweite Tendenz aus den links-aussen stehenden Segmenten im Militär heraus, die eher der Kommunistischen Partei Portugals (PCP) nahestand. Der Gruppe der Neun veröffentlichte am 7. August ein Dokument (Documento Melo Antunes), um sich von den Thesen des Volks-MFA-Bündnis vom 8. August 1975, die revolutionär gestimmt waren und die Kontrolle der Produktionsmittel anstrebten, zu distanzieren. Die Gruppe propagierte darin die Gründung eines pluralistischen und überparteilichen repräsentativ-demokratischen Staates, um so über einen Dritten Weg zum Sozialismus zu gelangen. Die Gruppe grenzte sich damit sowohl vom bürokratisch-autoritären UdSSR-Modell und von revolutionären Avantgarde-Konzepten ab, die die Gruppe als opportunistisches Instrumentalisieren der Gesamtbevölkerung durch eine schmale Garde betrachtete, als auch von der westlichen Sozialdemokratie, damit nicht auch in Portugal die Muster des fortgeschrittenen Kapitalismus reproduziert würden. Die Gruppe wollte zudem die Entwicklungen nach dem Regimeumsturz stabilisieren, indem die angestammten Institutionen re-etabliert würden.
Unter der Schriftleitung von Otelo Saraiva de Carvalho verfassten daraufhin links-aussen stehende Offiziere (einige mit Verbindung zu COPCON, dem Offizierskommando zur Erfüllung der Ziele vom 25. April 1974, sowie zwei Führer:innen des PRP-BR) ein Gegendokument (Autocrítica revolucionária do Copcon) für ein politisches Programm, worin eine Republik auf Grundlage basisdemokratischer Herrschaft der Bevölkerung vorgeschlagen wurde. Der linkskommunistische Partido Revolucionário do Proletariado (PRP-BR), der linkssozialistische Movimento de Esquerda Socialista (MES) und die maoistische União Democrática Popular (UDP) unterstützten diesen Vorschlag.
Am 25. November 1975 versuchte der linke Flügel des MFA einen Staatsstreich, indem Fallschirmspringer Luftwaffenstützpunkte und die Luftwaffenschule besetzten, um die Entwicklung Richtung Sozialismus zu garantieren. Die Gruppe der Neun hatte schon zuvor Ramalho Eanes mit der Ausarbeitung von Plänen beauftragt, um einen möglichen Staatsstreich unter der Führung links-aussen stehender Offiziere zu verhindern. Und ab dem 25. November antwortete die Gruppe der Neun unter der Verantwortung von Ramalho Eanes erfolgreich mit einem militärischen Gegenputsch. In der Folge wurde das links-aussen Offizierskommando (COPCON) aufgelöst und einheitliche Disziplin in der Armee hergestellt. Damit war der Linksdrall der Nelkenrevolution beendet, und die bürgerliche Ordnung würde nach und nach stabilisiert. Am 28. November 1975 nahm die 6. Provisorische Regierung ihre Amtsgeschäfte wieder wahr. Die erfolgreiche Durchführung des Gegenputsches würde Ramalho Eanes zudem den Aufstieg zum Generalstabschef der Armee und am 14. Juli 1976 zur Wahl zum erstem verfassungsmässigen Präsidenten der Dritten Republik eröffnen. Anm. d. Red.
An welchen Gesichtspunkten oder Momenten lassen sich diese Kommissionen als Erfahrungen der Doppelherrschaft analysieren? Gab es eine Koordinierung?
Im September fand in Covilhã, im Norden des Landes, dieses Mal unter der Führung der Reorganisationsbewegung der Proletarischen Partei (maoistisch), aber auch mit Beteiligung der Sozialistischen Partei (PS; Sozialdemokratie) und der Revolutionären Arbeiterpartei (trotzkistisch) ein nationales Treffen der Arbeiter:innenkomitees (encontro nacional de Comissões de Trabalhadores) statt. Der Kongress brachte 95 Arbeiter:innenausschüsse zusammen (53 mit Stimmrecht, 42 mit Beobachterstatus). Der Kongress erkannte jedoch auch, dass er dem Prozess keine revolutionäre Dynamik verleihen können würde und er eine Koordinierung der Ausschüsse auf nationaler Ebene schaffen musste. Die programmatischen Achsen, die aus den Erklärungen des Kongresses hervorgingen, waren der Kampf für den 8-Stunden-Tag, die 5-Tage-Woche, die Bewaffnung der Arbeiter:innenausschüsse in den von ihnen eingerichteten Komitees, die Ablehnung von Entlassungen und vor allem „die Entwicklung der Arbeiter:innenkontrolle über die gesamte Produktion, den Vertrieb und den Verbrauch“.[2]
Wichtiger war die Koordinierung durch den CIL – die die Arbeiterkomitees des Industriegürtels von Lissabon (Cinturão Industrial de Lisboa; CIL) zusammenbrachte. Der CIL war bei den „Mobilisierungen im Sommer und Herbst 1975, die zwischen zwei- und dreihundert Arbeiter:innenausschüsse in der Hauptstadt zusammenbrachten und die sich in den folgenden Monaten und Jahren zu ähnlichen regionalen Strukturen in Setúbal, Porto und Braga ausweiteten“, von grundlegender Bedeutung gewesen.
Und auch wenn der CIL eine grosse Anzahl von Führungspersönlichkeiten hatte, die mit der PCP verbunden waren, war der CIL bis 1975 doch keine monolithische Struktur gewesen, die von der PCP geführt wurde. Der CIL war „die organisierende Struktur der grossen Demonstration in Terreiro do Paço am 16. November 1975“ und rief zwischen September und November 1975 zu mehreren Demonstrationen mit einer sehr breiten Mobilisierungskraft auf, die von fast allen Parteien links des PS unterstützt wurden.

Welche Politik verfolgten die Kommunistische Partei und die Internationale Gemeinschaft in Bezug auf diese Kommissionen?
Als die Arbeiter:innenausschüsse des Industriegürtels von Lissabon am 8. November 1975 in Barreiro zum ersten Mal zusammentrafen, sprach sich die PCP für eine Politik der Aufrechterhaltung der Produktion aus, die von einem Produktionskontrollausschuss kontrolliert werden sollte, in dem „alle wichtigen Bereiche des Unternehmens“ vertreten waren. Die PCP erinnerte daran, dass es zu diesem Zeitpunkt 322’000 Erwerbslose gab, fast zehnmal mehr als am 25. April 1974, und vertrat die Auffassung, dass „die Krise der Arbeitslosigkeit nicht durch eine Verkürzung der Arbeitszeit“ zu lösen sei, sondern durch eine bessere Organisation der Arbeiter:innen, die Verstaatlichung des Aussenhandels und die „maximale Nutzung der Produktionskapazitäten“.[3]
Zusammengenommen würden diese Massnahmen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Unternehmer:innen die Profitrate wiederherstellen können. Für den PCP waren dies Massnahmen, die gemeinsam mit der „Erhöhung der Löhne der am schlechtesten bezahlten Arbeiter:innen“ und der Ablehnung von Entschädigungen für die ehemaligen Eigentümer:innen der verstaatlichten Unternehmen angewandt werden könnten.
Schliesslich sprach sich die Partei entschieden gegen die Schaffung eines nationalen Organs zur Koordinierung der Arbeiter:innenausschüsse aus. Mit dem Argument, dass diese die Rolle von Vermittlern der Volksversammlungen spielen sollten, aber ohne [überregionale] Koordinierung zwischen ihnen: „Wir sehen, dass die Schaffung eines institutionalisierten und endgültigen höheren Organs der Arbeiter:innenausschüsse zur Gefahr einer Zersplitterung der Bemühungen führen könnte und die Arbeiter:inennausschüsse von ihren grundlegenden Zielen ablenken könnte“.[4]
Die Arbeiterausschüsse waren keine national organisierte Alternative zur Intersindical, obwohl sie in den Fabriken oft eine Kraft waren, die die Macht der zentralen Gewerkschaft aufhob.
Es bestand ein gewaltiger Unterschied zwischen der Macht der Arbeiter:innenausschüsse in den Betrieben und Fabriken, die viel grösser war als diejneige der Intersindical, und ihrer embryonalen Organisation [ihrer Veranlagung, als Basis zum Aufbau staatlichen Verwaltungsstrukturen zu dienen; Anm. d. Red.].
Die Intersindical war mit einem ausgereifteren Apparat gewachsen, auch weil sie viele erfahrene Kader aus der Vergangenheit zusammengebracht hatte: Sie koordinierte auf nationaler Ebene, mit Delegierten, Zentralen, Kadern, Fonds…
Dennoch fand die revolutionäre Krise zwischen September und November 1975 statt, und die Arbeiter:innenausschüsse waren bereits in der CIL, dem Kampfkomitee von Setúbal (Comitê de Luta de Setúbal) und anderen embryonalen Koordinationsorganen organisiert. Der letztendliche Erfolg der nationalen Koordination der Arbeiter:innenausschüsse verdankte sich einer Dynamik, die die Führung der PCP in Frage stellte und vor allem als autonome und kämpferische Arbeiterorganisation inmitten der Revolution auftrat: „Wie Direktor D. Edinger, ein Mitglied des Arbeiter:innenausschusses von Setenave, über eine nationale Struktur der Arbeiter:inennausschüsse bemerkte: Wer eine solche Struktur beherrschte, würde faktisch das Land beherrschen.“[5]
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Desorganisation der Arbeiter:innenklasse, die durch die Verbote der Diktatur begünstigt wurde, letztlich zu einer Gegebenheit wurde, die den Staat 1974 und 1975 schwächte und gleichzeitig die Doppelherrschaft förderte.
Das organisatorische Vakuum war für den Staat ein beunruhigender Faktor, denn es eröffnete den Arbeiter:innenaussschüssen Raum. Im Vergleich zu Spanien, wo die CC.OO [Comisiones Obreras/ Arbeiter:innenkmmmissionen gründeten sich ab 1958; Anm. d. Red.] zu Beginn des Übergangsprozesses [nach dem Fall des Franco-Regimes 1975- 1977; Anm. d. Red.] bereits gut etabliert waren, gab es in Portugal nur eine kleine gewerkschaftliche Keimzelle, die genügend Raum für die Etablierung selbstständiger Arbeiter:innenausschüsse liess.
Aber die Unfähigkeit [der Arbeiter:innenausschüsse], sich in einem nationalen Gefüge, einem vereinigenden „Sowjet“, vertieft zu organisieren, verhinderte letztlich auch den organisierten Widerstand der einzigen, die gegen den konterrevolutionären Putsch vom 25. November 1975 dazu in der Lage gewesen wären.
Welche Rolle spielten die Kommunistische Partei Portugals (PCP) und die Sozialistische Partei (PS; Sozialdemokratie) während der Revolution?
Die Strategie der Portugiesischen Kommunistischen Partei zwischen dem 25. April 1974 und dem 25. November 1975 bestand darin, die Konsolidierung eines demokratischen Regimes in Portugal zu gewährleisten, mit dem Ziel, das Land im Rahmen eines reglementierten Kapitalismus innerhalb des Atlantischen Bündnisses relativ unabhängig von den Schwerpunktländern werden zu lassen.
In meiner Untersuchung habe ich dargelegt, dass die zentralen politischen Ziele der Partei zur Umsetzung dieser Strategie folgende waren:
1) eine breite demokratische Einheit mit Segmenten der Bourgeoisie und des Kleinbürgertums, was den Kampf gegen die rechtskonservative Seite einschliesst ebenso wie den Versuch, die extreme Linke zu isolieren;
2) die Einheit der Arbeiter:innenbewegung mit der Bewegung der Streitkräfte, das „Volks-MFA-Bündnis“;
3) der Aufbau einer einzigen, von der PCP zentralisierten Gewerkschaft, die als Struktur für die Einheit und Organisation der portugiesischen Arbeiter:innenbewegung und als strategische Reserve für die Rekrutierung von Menschen, Kämpfer:innenn und die finanziellen Ressourcen der PCP dienen soll;
4) die Kontrolle der Verstaatlichungen und der Agrarreform durch die Gewerkschaftsstrukturen in Zusammenarbeit mit dem Staat;
5) eine Politik des Widerstands gegen alle Produktionshindernisse, der sogenannten „Kampf der Produktion“, sei gegen Wirtschaftssabotage oder Streiks;
6) Beitrag zur „Entspannungspolitik“ zwischen den USA und der UdSSR und Zusammenarbeit bei der Unabhängigkeit der Kolonien unter der Führung von Befreiungsbewegungen, die von der UdSSR unterstützt werden;
7) Behinderung der Bildung von politischen Gegenmachtstrukturen oder -positionen (in einer Doppelmachtsituation), sei es in der Arbeiter:innenbewegung, der Bewegung der allgemeinen Bevölkerung oder den Streitkräften, sowie die Behinderung der nationalen Koordination der genannten.
1976 bedankte sich Kissinger persönlich bei Olof Palme [ehemaliger Ministerpräsident von Schweden; Anm. d. Red.] für seine Unterstützung von Mário Soares [war 19. April 1973 Gründer des PS; Anm. d. Red.] gegen die Nelkenrevolution.
Soares stand ideologisch Allende [Von 1970 bis 1973 Präsident von Chile, der mit einem Linksbündnis über demokratischen Weg eine sozialistische Gesellschaft in Chile errichten wollte; Anm. d. Red.], der in einem von Kissinger als US-Aussenminister mit-veranlassten Staatsstreich ermordet wurde, viel näher.
Zu dieser Zeit hatte die deutsche SPD den grössten Geldbetrag, der jemals an eine Partei ausserhalb Deutschlands überwiesen wurde, nach Portugal überwiesen, um den PS aufzubauen. Das Geld wurde verwendet, um Personal einzustellen, Zentralen zu eröffnen, Gewerkschaften, Rathäuser und Institutionen zu betreiben.
Das Gleiche geschah mit der PCP, mit Unterstützung der UdSSR, vor allem über die DDR. Der PS und die PCP kämpften darum, dieses Meer von Menschen (für sich) zu organisieren.
Soares überzeugte seine nationalen und internationalen Kolleg:innen von einer völlig neuen Strategie im Kontext der Revolutionen nach 1945: Die Niederschlagung der Revolution erfolgte nicht wie üblich durch einen blutigen Militärputsch und allgemeine Unterdrückung, sondern durch eine Mischung aus einem kontrollierten Militärputsch (25. November) und der Errichtung eines zivilen Regimes mit repräsentativer Demokratie.
Es war ganz anders als in Chile. Es begann im November 1975 mit der Durchsetzung der „Disziplin“, d.h. der Hierarchie in den Kasernen. Und schliesslich wurde die Konterrevolution durch einen Prozess der „demokratischen Konterrevolution“ gefestigt: Portugal ist das erste erfolgreiche Beispiel dafür, dass eine Revolution mit der Errichtung eines Regimes der repräsentativen Demokratie vereitelt wurde.
Dieses Modell wurde später in Francos Spanien und sogar in Chile, Brasilien und Argentinien in den 1980er Jahren angewandt und wurde als Carter-Doktrin bezeichnet. Sie könnte und sollte „Soares-Doktrin“ genannt werden.
Was ist mit den Parteien der maoistischen und trotzkistischen extremen Linken? Welche politische Strategie verfolgten sie während der Revolution?
Die portugiesische Revolution fand in den Jahren des grössten wirtschaftlichen und sozialen Wandels in der westlichen Welt seit der Nachkriegszeit statt. Der Mai 1968 läutete eine neue weltpolitische Situation ein, die durch zwei Faktoren gekennzeichnet war, die es in den zentralen Ländern seit der Niederlage des Nazifaschismus 1945 nicht mehr gegeben hatte: die Rückkehr der Arbeiter:innenklasse auf die politische Bühne und der Beginn vom Ende der Hegemonie der UdSSR-loyalen kommunistischen Parteien.
Aber es waren sehr fragile Tendenzen. Tatsächlich schwankten sie zwischen der Unterstützung der Strategie des PS und derjenigen der PCP hin- und her. Eine wirkliche Unabhängigkeitsstrategie war sehr marginal.
Wie kam es zu der Konterrevolution am 25. November 1975 und was geschah?
Es handelte sich eigentlich um einen konterrevolutionären Staatsstreich, der von den Sozialist:innen (Sozialdemokrat:innen) aber zivil geführt wurde, und zwar ohne den Widerstand der Kommunist:innen hervorgerufen zu haben.
Dieser Staatsstreich setzte der Doppelherrschaft in den Kasernen ein Ende. Am 25. November 1975 begann ein neues Regime, natürlich langsam, denn es dauerte mehr als zehn Jahre, bis die Revolution besiegt war, die Arbeitskräfte „flexibilisiert“ wurden (von 1986 bis 1989), die Agrarreform durchgeführt wurde (1982) und der Sozialstaat durch Privatisierungen immer weiter ausgehöhlt wurde (1989). Aber an diesem Tag, dem 25. November 1975, da wurde die Disziplin in der Produktion für die Kapitalakkumulation wieder aufgenommen. Etwas, das auch in der Rede des Militärchefs des Putsches, António Ramalho Eanes, anlässlich der Feierlichkeiten zum zweiten Jahrestag des 25. November 1975 öffentlich bekräftigt wurde.[6]
Wie wird diese Erfahrung heute in Portugal gesehen und welche Schlussfolgerungen können daraus gezogen werden?
Diese revolutionäre Vergangenheit, als die Ärmsten, die Schwächsten, oft Analphabet:innen, es wagten, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, ist heute eine Art historischer Albtraum für die derzeitige portugiesische herrschende Klasse. So sehr, dass sie darauf bestehen, dass 45 Jahre nach der Revolution [2019 veröffentlicht; Anm. d. Red.] nur der 25. April 1974 gefeiert werden soll, um ausser Acht zu lassen, dass dieser Tag der erste der 19 überraschendsten Monate in der Geschichte Portugals war.
Portugal war neben Vietnam das Land, das damals von der internationalen Presse am meisten verfolgt wurde. Die Bilder von Menschen aus den Favelas, die mit offenen Armen lächeln, neben bärtigen und fröhlichen jungen Soldaten, erfüllten die Menschen in Spanien, Griechenland, Brasilien mit Hoffnung…
Die meisten, die hier lebten, freuten sich. Eines der Merkmale von Fotos der portugiesischen Revolution, wie das auf dem Cover meines Buches, ist, dass die Menschen darauf fast immer lächeln. Es ist kein Zufall, dass Chico Barque sang: „Ich weiß, dass du feierst, Alter“ (“Sei que está em festa, pá.”).
Übersetzung durch Redaktion
Quellenverzeichnis:
[1] Santos, Maria de Lurdes, Lima, Marinús Pires de, Ferreira, Vítor Matias, O 25 de abril e as Lutas Sociais nas Empresas, Porto, Afrontamento, 1976, 3 volumes.
[2] «Viva a Classe Operária», órgão do Secretariado Nacional das Comissões de Trabalhadores, Ano I, 10 de outubro de 1975, In Pasta «Portugal, 1974-1975», Arquivo do International Institute for Social History, Amsterdam.
[3] «Encontro de trabalhadores da Cintura Industrial de Lisboa». In Avante!, Série VII, 13 de novembro de 1975, p. 5.
[4] Ibidem
[5] Pérez, Miguel, Contra a Exploração Capitalista. Comissões de Trabalhadores e Luta Operária na Revolução Portuguesa (1974-75), Dissertação de Mestrado em História dos Séculos XIX e XX, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, agosto de 2008, p. 143.
[6] EANES, Ramalho, «No 2.º aniversário do 25 de novembro», Discurso proferido em Tancos. In Secretaria de Estado da Comunicação Social, 1978, p. 10.