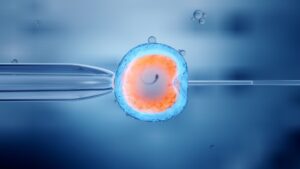Vor 100 Jahren stürzten die russischen Arbeiter*innen, Bäuer*innen und Soldaten die bürgerliche Provisorische Regierung und eroberten unter Leitung der Bolschewiki die politische und ökonomische Macht im damaligen Russland. Der Sturz der Kapitalherrschaft durch Arbeiter*innen-, Soldaten- und Bäuer*innenräte beflügelte die Arbeiter*innenbewegungen auf der ganzen Welt. Doch der Traum einer auf Freiheit und sozialer Gleichheit beruhenden Gesellschaft währte nur kurz. Die unter den Bedingungen des grausamen Bürgerkrieges entstandene und unter Stalin errichtete, bürokratische Diktatur in der Sowjetunion diskreditieren sozialistischen Ideen bis heute. In einer dreiteiligen Serie möchten wir nun die historischen Ereignisse des revolutionären Russlands 1917 aufarbeiten, die zentralen Fragen beleuchten und damit nicht nur der stalinistischen, sondern auch der bürgerlichen Geschichtsschreibung, die auch heute noch in der Russischen Revolution das Grundübel des 20. Jahrhunderts erkennt, Gegensteuer geben. (Red.)
von Manuel Kellner; aus SoZ
Februarrevolution und Aprilthesen
Im Jahr 1916 hatte es in Russland wieder viele Streiks gegeben. Mit den Niederlagen im Krieg wuchs die Unzufriedenheit in den Städten und auf dem Land. Russland war in Gärung. In der Hauptstadt St. Petersburg wurden die Schlangen um Brot immer länger. Am 23. Februar 1917 war Internationaler Frauentag (nach dem alten julianischen Kalender; nach dem gregorianischen war es am 8. März). Die Textilarbeiterinnen einiger Fabriken traten an diesem Tag in den Streik. Sie gehörten zu den am schlechtesten bezahlten und behandelten Arbeiterinnen. Viele von ihnen waren zugleich Ehefrauen von Soldaten. Sie schickten Delegationen zu den Belegschaften der Metallarbeiter mit der Aufforderung, sich der Streikbewegung anzuschließen. Das Komitee der Bolschewiki von Wyborg, einem rein proletarischen Bezirk St. Petersburgs, hatte sich gegen solche Aktionen ausgesprochen (die Stadtleitung der Partei war wegen Verhaftungen handlungsunfähig). Nach seiner Einschätzung mussten sie zu einer verfrühten Konfrontation mit dem Zarenregime führen. Doch an diesem Tag streikten 90’000 Arbeiterinnen und Arbeiter, ihre Hauptforderung war «Brot!» Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass das Zarenregime fünf Tage später hinweggefegt sein würde.
Die Bewegung steigerte sich von Tag zu Tag, bis sie faktisch zum Generalstreik wurde und unter anderem das Ende der Selbstherrschaft des Zaren forderte. Die Polizei, die in die Menge schoss, wurde entwaffnet. Die Schlüsselfrage war jetzt das Verhalten der Armee. Im Kontakt mit den Aufständischen wechselten die Soldaten der Garnisonen nach einigem Zögern das Lager und schlossen sich dem Aufstand an. Die Truppenteile, die die Regierung ausschickte, um die Bewegung niederzuschlagen, lösten sich eins nach dem anderen auf. Das Zarenregime brach zusammen.
Nach dem Sieg in der Hauptstadt dehnte sich die Bewegung auf Moskau und die Provinzstädte aus. Große Teile der Bauernschaft setzten sich gegen die Großgrundbesitzer in Bewegung und forderten Land und Frieden. Bald war ganz Russland von Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräten überzogen.
Diese bildeten eine demokratisch organisierte Gegenmacht von unten, während die Provisorische Regierung der Konstitutionellen Demokraten («Kadetten») von den «gemäßigten» Sozialisten (Menschewiki und Sozialrevolutionäre) gestützt wurde, die schließlich auch in sie eintraten. Die «Kadetten» repräsentierten das Kapital bzw. das liberale Bürgertum und führten den Krieg fort.
Damit entstand eine Situation der «Doppelherrschaft». Bis zur Rückkehr Lenins aus dem Exil [in der Schweiz; er kam im April 1917 in Russland an] verhielten sich die Bolschewiki gegenüber dieser Regierung als konstruktive Opposition. Ihre Perspektive war von der alten bolschewistischen Losung der «demokratischen Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft» geprägt, die den Weg für eine normale kapitalistische Entwicklung frei machen sollte, bevor eine sozialistische Revolution vorbereitet werden konnte.
Lenin schlug mit seinen «Aprilthesen» eine ganz andere Orientierung vor. Weil mit der bürgerlichen Regierung das Kapital an der Macht war, war der Krieg für ihn auch auf Seiten Russlands ein imperialistischer Krieg, der aufhören musste. Die Doppelherrschaft musste beendet werden mit der Eroberung der politischen Macht durch die «Sowjets» – alle Macht den Räten!
Damit käme die Arbeiterklasse zusammen mit den ärmsten Teilen der Bauernschaft an die Macht. Grund und Boden sollten verstaatlicht und den Bauernfamilien gegeben werden. Statt der sofortigen sozialistischen Vergesellschaftung sollte zunächst die «Kontrolle» der Produktion eingeführt werden: Keine Entscheidung gegen den Willen der Belegschaften! Entscheidend sei das Heranreifen der sozialistischen Weltrevolution (vor allem der Revolution in Deutschland), für die die russische Revolution nur der Auftakt sein könne. Zugleich betonte Lenin in seinen Thesen, dass eine geduldige Überzeugungsarbeit erforderlich sein würde, um in den Räten Mehrheiten für diese Perspektiven zu erringen.
In der Tat waren die Bolschewiki zu dieser Zeit noch eine kleine Minderheit in den Räten. Die Führer der «gemäßigten» Sozialisten warfen Lenin wegen seiner Thesen «Fieberphantasien» vor. Aber auch in der Führung der bolschewistischen Partei stieß er zunächst auf ungläubiges Staunen, Widerspruch und Widerstand. Vor allem gestützt auf die politisch fortgeschrittensten Arbeiter und Arbeiterinnen in der Partei, die auch in der Februarrevolution eine führende und politisch inspirierende Rolle gespielt hatten (sie hatten die Erfahrungen der russischen Revolution von 1905 verarbeitet), konnte Lenin schließlich die Mehrheit der Bolschewiki für seine Orientierung gewinnen.
Bis zum Oktober 1917 der alten Zeitrechnung [sprich dem julianischen Kalender] gab es noch viele Wendungen, bis die von Lenin ausgegebene Orientierung die Mehrheit in den Räten eroberte und die Oktoberrevolution die Kapitalherrschaft in Russland stürzte. Diese viel diskutierten Erfahrungen stützten die bolschewistischen Positionen. Lenins «Fieberphantasien» wurden wahr.
Der Krieg und sein Klassencharakter
Vier Tage, nachdem Lenins Aprilthesen öffentlich geworden waren, erklärte die unter der Leitung von Kamenew und Stalin stehende bolschewistische Zeitung Prawda: «Was das allgemeine Schema des Genossen Lenin betrifft, so erscheint es uns unannehmbar, insofern es von der Einschätzung der bürgerlich-demokratischen Revolution als einer abgeschlossenen ausgeht und mit der sofortigen Umwandlung dieser Revolution in eine sozialistische Revolution rechnet.» Das bedeutete auch eine zweideutige Haltung zur Provisorischen Regierung und zum Krieg. Die Zarenherrschaft war gestürzt. Verteidigte die russische Armee denn jetzt nicht die Revolution gegen das deutsche Kaiserreich? Lenin erreichte in der bolschewistischen Partei bald eine Mehrheit für seine Position, und dazu gehörte die Forderung, den Krieg zu beenden.
Trotzki schrieb in seiner Geschichte der russischen Revolution: «Vom Baltischen bis zum Schwarzen Meer, vom Schwarzen bis zum Kaspischen, und weiter in das Innere Persiens, auf der unübersehbaren Front, standen 68 Infanterie- und 9 Kavalleriekorps. Was sollte mit ihnen nun werden? Was mit dem Kriege?» Schon im Februar, März und April waren die meisten Soldaten zunehmend kriegsmüde, zumal es sie drängte, nach Hause zu gehen und sich die gutsherrlichen Ländereien anzueignen. Dennoch schwankte die Masse der Soldaten – sie waren gegen Angriffshandlungen, aber immer noch halb bereit, in der Verteidigung zu verharren, um die Revolution zu schützen.
Lenin sah einen großen Unterschied zwischen der Haltung der Provisorischen Regierung unter dem Fürsten Lwow als einer Regierung des Kapitals und der Grundbesitzer und der Haltung der Arbeiter und Arbeiterinnen, Soldaten und armen Bauern. Wenn die Regierenden von der Verteidigung des Vaterlands und der Revolution sprachen, dann wollten sie das Volk betrügen und den Krieg als imperialistischen Raubkrieg weiterführen. So sprach der Außenminister Miljukow von Offensiven zur Eroberung von Teilen Kleinasiens und Konstantinopels. Wenn einfache Leute von Verteidigung sprachen, dann meinten sie ehrlich die Verteidigung der Revolution. Den imperialistischen Charakter des Krieges auch von Seiten Russlands erkannten sie nicht. Man musste sie geduldig aufklären und den politischen Lernprozess unterstützen, den die jeweils neuen Ereignisse auslösten.
Eine solche Erfahrung war eben die offen imperialistische Sprache Miljukows. Der war bald nicht mehr zu halten. Am 5. Mai 1917 wurde er durch Kerenski ersetzt, der sich der Sozialrevolutionären Partei angeschlossen hatte. Das war die zweite Regierung Lwow und zugleich die erste Koalitionsregierung, an der auch Vertreter der «gemäßigten Sozialisten» teilnahmen, also der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki. Diese Regierung sprach nun von einer Vorbereitung der Armee für «defensive und offensive Aktionen zur Abwendung einer etwaigen Niederlage Russlands und seiner Verbündeten», der Entente (Frankreich, Großbritannien, und inzwischen waren auch die USA in den Krieg eingetreten). Sie sprach auch von einer «aktiven Außenpolitik zugunsten des Friedens». In Wirklichkeit wollte die Regierung sich auf den Krieg stützen, um die Fortschritte der Revolution zu hemmen und alle wichtigen Fragen – wie die Einberufung der Konstituierenden Versammlung und die Agrarreform – zu verschieben. Patriotische Gefühle sollten ihr eine Bindung zu breiteren Massen verschaffen. Zugleich wurde die Rätebewegung immer stärker, und in ihr eroberten die Bolschewiki langsam aber sicher Unterstützung für ihre Positionen.
Diese erklärte Lenin zum Beispiel am 7. Mai 1917 [nach dem alten Kalender; nach dem neuen war es am 20. Mai] in einem Offenen Brief an die Delegierten des Gesamtrussischen Kongresses der Bauerndeputierten. Zur Frage des Krieges führte er aus, dass dieser Krieg ein Eroberungskrieg sei, den die Kapitalisten aller Länder zu Eroberungszwecken führen, um ihre Profite zu erhöhen. Die Bolschewiki als «Partei der klassenbewussten Arbeiter und der armen Bauern» lehnten es ab, den Krieg der eigenen Kapitalisten zu rechtfertigen. Die gemäßigten Sozialisten, die an der Regierung beteiligt waren, wollten Kapitalisten und Gutsbesitzer davon überzeugen, einen gerechten Frieden zu schließen. In Wirklichkeit würden sie ihnen aber helfen, den Krieg und seine Leiden in die Länge zu ziehen.
Lenin prangerte das Festhalten der Regierung an den Geheimverträgen an und erklärte, dieser verbrecherische Krieg müsse sofort beendet werden, nicht durch einen Separatfrieden mit Deutschland, sondern durch einen allgemeinen Frieden «gegen die Kapitalisten». Dafür müsse die Staatsmacht in die Hände der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte übergehen.
Die Bolschewiki verbanden die Haltung zum Krieg mit dem Klassencharakter von Regierung und Staat. Eine Rätemacht, mit der die Arbeitenden und armen Bauern herrschen würden, hätte ihrerseits alles Recht der Welt, sich gegen imperialistische Aggression auch militärisch zu verteidigen. Erst die junge Sowjetrepublik brachte Anfang März 1918 den Frieden mit Deutschland – auf unerwartete und schmerzhafte Weise.
Die Rolle der bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit
Einer der vielen kontrafaktischen Gemeinplätze aus der Stalinschen Fälscherschule ist die Behauptung, Trotzki habe die «Bauernfrage» unterschätzt. In Wirklichkeit steht in Trotzkis Ergebnisse und Perspektiven (geschrieben unmittelbar nach der russischen Revolution von 1905) das Gegenteil. Die entscheidende Frage war demnach schon damals seiner Meinung nach, die Aufgaben der bürgerlichen Revolution zu lösen, in deren Mittelpunkt die Agrarreform stand, also die Frage der Befreiung der bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit aus den halbfeudalen Verhältnissen.
Welche von beiden entgegengesetzten Gesellschaftsklassen konnte diese Frage lösen und den Bauern das Land geben? Aus Trotzkis wie aus Lenins Sicht war das russische Bürgertum dazu nicht in der Lage. Das Proletariat, die Arbeiterklasse, konnte und musste dieses Problem im Bündnis mit der Bauernschaft lösen.
Im Gegensatz zu Lenin bis Anfang 1917 war Trotzki allerdings außerdem der Meinung, dass die Arbeiterklasse zusammen mit den ärmsten Schichten der Bauernschaft dafür die politische Macht erobern und einen – nationalen wie internationalen – Prozess der «permanenten Revolution» auslösen musste, wozu auch erste «sozialistische Maßnahmen» im eigenen Interesse gehören würden. Umgekehrt würde die russische Arbeiterklasse die politische Macht niemals erobern können, ohne sich auf die bäuerliche Bevölkerungsmehrheit und deren Kampf gegen Großgrundbesitzer, Kirchen- und Klöstereigentum zu stützen.
Das Kapitel «Die Bauernschaft» in Trotzkis Geschichte der russischen Revolution beginnt mit dem Satz: «Das Fundament der Revolution bildete die Agrarfrage». Nach der Februarrevolution war es auf dem Lande zunächst verhältnismäßig ruhig geblieben. Die jungen Männer waren als Soldaten an der Front, die älteren erinnerten sich an furchtbare Strafexpeditionen. Doch ab März 1917 zeigten sich die ersten Erscheinungen des Bauernkriegs. Die Bürgerlichen und die ihnen beipflichtenden «gemäßigten» Sozialisten warnten davor, die Lösung der Agrarfrage zu schnell zu forcieren – aus Angst davor, die Agrarbewegung könnte aus dem Ruder laufen. Erste handfeste Konflikte ergaben sich, als die Gutsbesitzer die Frühjahrsaussaat zurückhielten, und das obwohl der Boden angesichts der schwierigen Ernährungslage nach Bebauung schrie. Außerdem begannen die Gutsbesitzer aus Angst vor Enteignungen, ihre Güter zu liquidieren, indem sie sie an reiche Bauern, Kulaken, verkauften, die ihrer Meinung nach eher um Expropriationen herumkommen würden.
Die Formen, die der bäuerliche Kampf annahm, wurden im Lauf der Monate immer radikaler. Zu Anfang dominierte der Wunsch, die Konflikte nicht zuzuspitzen, sondern die Großgrundbesitzer durch Argumente und gute Worte zu überzeugen. Der I. Gesamtrussische Kongress der Bauerndeputierten in Petrograd [St. Petersburg] Mai 1917 drückte noch die gemäßigten Stimmungen aus.
Wie meist bei repräsentativen Körperschaften blieb er hinter dem sich rasant entwickelnden Bewusstsein an der Basis zurück. Der rechte Flügel der Sozialrevolutionäre gab den Ton an.
Immerhin forderte der Kongress: «Übergang des gesamten Bodens in den Besitz des Volkes zur ausgleichenden werktätigen Benutzung ohne jegliche Ablösung.» Diese Formel verstanden die Großbauern als Gleichstellung mit den Großgrundbesitzern. Von den kleinen Bauernfamilien und den Landarbeitern wurde sie aber radikal-demokratisch interpretiert. Dieses «kleine Missverständnis», kommentiert Trotzki, würde sich erst in «der Zukunft» auflösen. Ohne dieses «Missverständnis» wäre der Oktoberumsturz jedoch nicht denkbar gewesen.
Die Sozialrevolutionäre verurteilten im Mai jegliche «eigenmächtige» Landaneignung. Sie koppelten die Durchführung der Agrarreform an die Einberufung der Konstituierenden Versammlung. Aber die bürgerlichen und die «gemäßigten» sozialistischen Kräfte schoben ja auch die Einberufen der Konstituierenden Versammlung immer weiter hinaus. Ein bürgerlicher Liberaler wollte ein geflügeltes Wort schaffen mit der Behauptung: «Je linker die Regierung, desto rechter das Land». Lenin antwortete ihm in einer Weise, die den meisten seiner Zuhörer als Paradox erschien: In Wirklichkeit seien die Massen, die Arbeiterinnen, Arbeiter und armen Bauern, tausendmal linker als die «gemäßigten» sozialistischen Führer und sogar noch hundertmal linker als sogar die Bolschewiki: «Wenn Sie leben werden, werden Sie es sehen.»
Anfang Juni 1917 trat der I. Gesamtrussische Kongress der Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten zusammen, dominiert von Menschewiki und Sozialrevolutionären, wenn auch die Bolschewiki in den Sowjets nun stärker vertreten waren als bislang. Dieser Kongress bemühte sich, der von der Provisorischen Regierung beschlossenen Offensive an der Front eine politische Deckung zu geben. In der Hauptstadt Petrograd fand eine sehr große Demonstration von Arbeiterinnen, Arbeitern und Soldaten statt, zu der Sozialrevolutionäre, Menschewiki und Bolschewiki gemeinsam aufgerufen hatten. Diese Demonstration «schlug um in eine bolschewistische Demonstration gegen die Versöhnler», wie Trotzki schrieb. Das war das Vorspiel zu den «Julitagen», jener wichtigen Etappe auf dem Weg zum Oktoberumsturz.