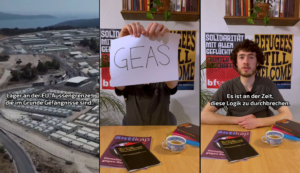Aufgerüstete Grenzen, verheimlichte Gefängnisse in Asylanlagen, illegale Pushbacks und existenzieller Mangel: An den EU-Aussengrenzen werden Schutzsuchende systematisch entrechtet und verfolgt. Petar Rosandić ist Gründer der NGO SOS-Balkanroute, die sich an der bosnisch-kroatischen Grenze gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung gegen dieses brutale System wehrt. Nach seinem Besuch am diesjährigen Anderen Davos vermittelt uns Petar in diesem Interview einen Eindruck der Situation im Kontext der erstarkenden Rechtsextremen und drastischen Verschärfungen im Grenzregime. Zudem zeigt er auf, weshalb Engagement für Geflüchtete mit der Stärkung der lokalen Bevölkerung an den EU-Aussengrenzen einhergehen muss.
Interview mit Petar Rosandić; von AG Antirassismus und Abolitionismus (BFS Zürich)
Wie an allen EU-Aussengrenzen verschlimmerte sich die Situation für geflüchtete Menschen auf der sogenannten Balkanroute drastisch. Geschlossene Grenzen, illegale und gewalttätige Pushbacks, sowie völlig unzureichende und unmenschliche Bedingungen in den Geflüchteten-Camps entrechten schutzsuchende Menschen systematisch und versetzen sie in oft lebensbedrohliche Situationen. Jedoch wird die Balkanroute, sowie die brutalen Äusserungen der europäischen Migrationspolitik entlang dieser, häufig völlig vergessen oder absichtlich verdrängt.
Die Organisation SOS-Balkanroute engagiert sich für diese geflüchteten Menschen, die beinahe aus allen Nachrichten verschwunden sind und organisiert seit 2019 entlang der Balkanroute Sammelaktionen und Spendentransporte. Zudem leisten sie medizinische Versorgung und bauen ein Helfer:innennetzwerk entlang der Balkanroute auf. Wir durften Petar Rosandić von der SOS-Balkanroute interviewen.
Petar Rosandić, du hast 2019 die Initiative «SOS-Balkanroute» gegründet. Wie hat sich die Situation für Geflüchtete an den EU-Aussengrenzen seither verändert?
Petar Rosandić: Im Grunde hat sich die Situation für Geflüchtete an den EU-Aussengrenzen nicht geändert. Auf die einzelnen Schicksale der Geflüchteten projiziert sind es die gleichen Probleme, die gleichen Hürden, die gleichen Schikanen und die gleichen lebensbedrohlichen Umstände. Es sind die gleichen Polizist:innen, die die Menschen mit Gewalt zurückschlagen oder sie ihres Hab und Guts berauben. Natürlich ist es auch immer noch so, dass Menschen ohne finanzielle Mittel diejenigen sind, die am stärksten bedroht und am vulnerabelsten sind und erst nach etlichen Versuchen oder überhaupt nicht weiterkommen. Durch die Verschärfungen des europäischen Grenzregimes, die massive Polizeipräsenz und Frontex sind Geflüchtete noch mehr angewiesen auf Schmuggler und sind ihnen noch mehr ausgeliefert. Die vorherrschende Asylpolitik beflügelt somit, nebst ihrer krassen Brutalität, sogar noch das ”Business” der Schmuggler.
Im Juni 2024 ist in der EU die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (kurz: GEAS) in Kraft getreten. Als Mitglied des Dublin-Systems soll die Schweiz diese krassen Verschärfungen ebenfalls übernehmen. Noch kämpfen wir dagegen an. Wie hat sich durch das GEAS eure Arbeit und das Leben der Geflüchteten verändert?
Konkret auf unsere Arbeit bezogen, also auf die bosnisch-kroatische Grenze, ist noch nicht wirklich spürbar, welche Auswirkungen die GEAS-Reform auf uns und das Leben der Geflüchteten haben wird, weil das GEAS erst nächstes Jahr implementiert werden soll. Wir wissen aber, dass es auf der kroatischen Seite der Grenze ein gefängnisartiges Lager gibt, welches bis heute zum Glück kaum in Betrieb war. Es ist anzunehmen, dass dieses Lager eine tragende Rolle im Rahmen des GEAS an der bosnisch-kroatischen Grenze spielen wird. Ansonsten stellt sich die Frage, ob nicht das illegal errichtete Gefängnis im bosnischen Flüchtlingslager Lipa [1] in einem Zusammenhang steht mit den neuen GEAS-Strukturen. Das konnte und wollte uns aber niemand beantworten. Mittlerweile gibt es einen gültigen Abrissbescheid für dieses Gefängnis. Insofern haben wir wahrscheinlich ein kleines «mini»-Stück dieses ganzen GEAS-Prozesses verhindert.
Neben dem GEAS gibt es zahlreiche weitere repressive Strukturen, die versuchen Geflüchteten jegliche Möglichkeit zu nehmen, ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde zu führen. Ihr und SOS-Balkanroute wurdet in der Vergangenheit mehrfach auch direkt angegriffen. Welche Strategien wenden rechte Kräfte an, um euch zu drangsalieren?
Virtuell fluten sie uns mit abwertenden Kommentaren mit den gängigsten Klischees oder verbreiten Hassnachrichten durch Telegram-Gruppen. Natürlich erfahren wir auch öfters, zum Beispiel bei Demonstrationen, Bedrohungen und Beschimpfungen. Zu rechten Strukturen würde ich natürlich auch gewisse institutionelle Strukturen zählen, die versucht haben, uns zu bekämpfen und mit lächerlichen Klagen einzudecken. Insofern finden die rechte Hetze und Repression heutzutage auf mehrfachen Ebenen statt. In Österreich gibt es eine Tradition des Helfens, der Mitmenschlichkeit, die tief verankert ist, zum Beispiel in regionalen Medien. Aber manche regionalen, rechten Medien schweigen uns tot, weil wir ihnen zu rebellisch sind, weil wir die Wahrheit sagen.
«Zu rechten Strukturen würde ich auch gewisse institutionelle Strukturen zählen – rechte Hetze und Repression findet heutzutage auf mehrfachen Ebenen statt.»
SOS-Balkanroute zeichnet sich ja auch dadurch aus, das ihr auch die lokale Gemeinschaften der ständigen Bewohner:innen an den Aussengrenzen stärkt. Wir gehen davon aus, dass das anfangs nicht einfach war? Wie habt ihr das Vertrauen der lokalen Bevölkerung gewinnen können?
Ja, das hat auf jeden Fall so zwei bis drei Jahre gedauert, bis wir wirklich in der lokalen Gesellschaft angekommen sind. Die Anknüpfungspunkte zur lokalen Bevölkerung waren wie so oft progressive Frauenvereine vor Ort und Leute, die sich in der Zivilgesellschaft engagiert haben. Unser Ansatz ist nicht, ganz alleine unser Projekt an den EU-Aussengrenzen durchzuziehen, sondern wir schauen uns an, was die lokalen Gegebenheiten hergeben, wo wir unterstützen können, wo wir bestehende Strukturen, Institutionen und gesellschaftliche Mechanismen stärken können. Das ist eine Form der Nachhaltigkeit, man ist nicht zwei Jahre in einem Projekt und dann plötzlich weg und hinterlässt ein Loch, ein Chaos für die Menschen vor Ort. Man versucht eben mit den Menschen vor Ort – das geht hinauf bis zu Bürgermeister:innen – in einen Dialog zu treten.
Als wir angefangen haben, war die Zahl an Geflüchteten enorm gross und es gab keine geeigneten Unterkünfte für Geflüchtete. Die Stadt Bihać an der Grenze mit 60’000 Einwohner:innen hatte plötzlich einige tausend obdachlose Geflüchtete auf der Strasse. Bihać ist ein grosser Hotspot der Balkanroute. Vor allem die Kälte der Wintermonate, der Schnee und der Frost machen den Menschen sehr zu schaffen. In diesen Momenten war die Anspannung gross und die Atmosphäre aufgewühlt. Wir mussten zeigen, dass wir nicht nur die Armut und die Situation der Geflüchteten sehen, sondern auch die Armut und die bedrohliche Situation des Auswanderungslandes Bosnien-Herzegowina. Schüler:innen in Bihać hatten beispielsweise während Corona nicht genügend Computer – da haben wir Computer gebracht. In der ganzen Stadt gab es auch nur einen einzigen Rettungswagen und nur mangelhafte Feuerwehrausrüstung. Diese konnten wir mit Unterstützung zum Beispiel aus der kommunistischen Regierung in Graz organisieren. Wir versuchen so Hand in Hand zu arbeiten und zu schauen, dass wir einen lokalen Impact entwickeln können und dass wir trotzdem das grosse Ganze nicht aus den Augen verlieren.
Bosnien zählt zu den ärmsten Ländern in Europa und hat hohe Arbeitslosenquoten. Wie hat sich die Situation der lokalen Bevölkerung seit 2019 verändert – und inwiefern haben sich diese Veränderungen auf eure Arbeit ausgewirkt?
Die Situation hat sich insofern geändert, als dass es jetzt diese Lager für Geflüchtete gibt, die gebaut wurden von der EU, weit weg von der Stadt, quasi in Isolation. Es gibt 27 Kilometer weit und breit keine soziale Infrastruktur und wenn die Menschen zum Supermarkt gehen wollen, müssen sie fünf bis sechs Stunden zu Fuss gehen. Wir bemühen uns zusammen mit vielen lokalen progressiven Leuten darum, dass letztendlich doch die Menschlichkeit gewinnt, trotz all den Strapazen. Wir sehen zum Beispiel wie eine Bäuerin in der Nähe der kroatischen Grenze, wo Menschen eben oft zurückgeschlagen werden, Geflüchteten die Haustür aufmacht, ihnen einen Kaffee macht und ihnen die Möglichkeit bietet, sich zu duschen und zu regenerieren. Oder Schüler:innen einer Schule in der Nähe des Pushback-Gebiets, die den Wasserschlauch für die Geflüchteten rausstellen. Das sind kleine Aktionen, die zeigen, dass in Bosnien Empathie vorherrscht, dass die bosnische Bevölkerung aufgrund ihrer Geschichte und dem Krieg, der noch immer in den Köpfen und in der Gesellschaft omnipräsent ist, zu einem Grossteil nachvollziehen kann, was diese Menschen durchmachen. Dies, obwohl die bosnische Bevölkerung nicht die Mittel haben wie westliche Gesellschaften. Deswegen braucht es uns auch.
Petar Rosandić
SOS-BalkanrouteAutokratisch-rechtsextreme Kräfte werden weltweit stärker, in Österreich wäre beinahe die FPÖ an die Regierung gelangt mit Herbert Kickl an der Spitze, der sich dem Nazi-Jargon entsprechend «Volkskanzler» nennt. Wie bringst du alle diese Entwicklungen zusammen? Was sind die Gründe dafür und welche Rolle spielt dabei der Umgang mit Geflüchteten?
Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, egal jetzt ob in der Schweiz, in Österreich oder in Deutschland, ist Migration das dominierende Thema und immer wiederholen sich die gleichen Narrative. Rechte haben aus Migration ein «Sicherheitsthema» gemacht. In der Folge haben sie so systematisch die Menschenrechte abgebaut und die Grenzgebiete an den EU-Aussengrenzen de facto in rechtsfreie Räume verwandelt.
«Rechte haben aus Migration ein ”Sicherheitsthema” gemacht und die Grenzgebiete an den EU-Aussengrenzen de facto in rechtsfreie Räume verwandelt.»
Denn es gibt keine Sanktionen beispielsweise für die kroatischen Polizist:innen, die Menschen geschlagen haben und dabei identifiziert wurden. Das kann morgen genauso gegen eine andere Gruppe gehen. Dies vergessen viele Menschen, die die Brutalität des europäischen Grenzregimes an den EU-Aussengrenzen stillschweigend zur Kenntnis nehmen. Morgen könnte vielleicht die LGBTQIA+ Community, die serbische Minderheit in Kroatien oder eine andere Gruppe dran sein. Und der ganze Kontinent schaut zu und fördert das auch noch mit Steuergeldern und Waffen.
Wie geht ihr bei SOS-Balkanroute mit der krassen Rechtsentwicklung um? Wie schätzt du das Potenzial von Community-Arbeit ein, wie ihr sie mit der lokalen Bevölkerung pflegt, um der Rechtsentwicklung entgegenzutreten?
Ich glaube, dass wir oft ein positives Beispiel bieten können, in dem Sinne, dass hier eine Vertrauensebene mit der lokalen Bevölkerung besteht und sich in diesem Raum Bihać entlang der bosnisch-kroatischen Grenze letztendlich die Humanität durchgesetzt hat. Es wurden schlimme Camps geschlossen, das Horror-Camp Vučjak wurde 2019 geschlossen und evakuiert, das illegale Gefängnis im Camp in Lipa wurde nicht in Betrieb genommen. Das sind schon Erfolge, die uns Hoffnung geben bei unserer Arbeit, auch wenn dies nur ein kleiner Abschnitt im System ist. Grundsätzlich glaube ich daran, dass man viel mehr lokale Strukturen unterstützen muss, wie zum Beispiel die polnische Gruppe «Grupa Granica», die an der polnisch-belarussischen Grenze aktiv ist. Denn lokale Helfer:innen sind das ‘A und O’ für den Schutz von Geflüchteten. Wir brauchen solche Menschen, denn wir wissen alle was passiert: Folter, Kidnapping, maskierte Banden und Polizist:innen, Grenzpolizei und massive Rechtslosigkeit, rechtsfreie Räume.
Ihr pflegt eine starke Erinnerungskultur, habt Gedenkveranstaltungen organisiert und Grabsteine für Geflüchtete aufgestellt, die im Fluss Drina an der bosnisch-serbischen Grenze ertrunken sind. Wir haben kürzlich in Zürich eine Veranstaltung durchgeführt zur Erinnerung an vier Asylsuchende, die 1989 bei einem Brandanschlag auf eine Asylunterkunft in Chur umgebracht wurden. Wie wichtig ist eine linke Erinnerungskultur?
Wir versuchen eine Erinnerungskultur zu etablieren, indem wir die Gräber der geflüchteten Menschen, die in Flüssen im Balkan ertrunken sind, in Ordnung bringen und schauen, dass sie nicht verfallen. Wir schauen, dass sie Grabsteine bekommen, dass sie Gedenkstätten bekommen, dass es Denkmäler gibt für diese Menschen. In diesem Rahmen haben wir 63 Grabsteine und drei Friedhöfe von Geflüchteten gestaltet, gemeinsam mit engagierten Aktivist:innen vor Ort, mit Patholog:innen die die Leichen obduzieren und mit kirchlichen Institutionen. Bei der Einweihung des letzten Friedhofs in Bosnien waren sowohl ein Imam, ein serbisch-orthodoxer Priester als auch ein römisch-katholischer Pfarrer gemeinsam anwesend, was sehr selten ist in Bosnien. Natürlich geht das von uns aus, von einer aus der linken Szene kommenden NGO, aber diese Erinnerungskultur geht weit darüber hinaus. Sie verbindet religiöse Menschen oder andere engagierte Menschen vor Ort, die das gleiche fühlen wie wir, wenn wir vor diesen Gräbern stehen, die ein Schandmahl sind für die Europäische Union.

Was erwartest du von den kommenden Jahren? Was kommt auf dich und SOS-Balkanroute zu, was auf uns Aktivist:innen?
Ich glaube es wird alles noch restriktiver und repressiver. Die neue österreichische Bundesregierung hat zum Beispiel jetzt die Familienzusammenführung gestoppt, das ist gegen die europäische Menschenrechtskonvention, das ist gegen das Recht auf Familienleben. Insofern sehe ich uns auch im juristischen Kampf, der wird umso wichtiger werden. Denn die Justiz ist offensichtlich der letzte Anker für diese vielen schönen Papiere, die wir nach dem zweiten Weltkrieg geschrieben haben. Ansonsten sehe ich den Bedarf, dass wir noch mehr Leute gewinnen, mehr Allianzen schliessen müssen und uns breiter aufstellen müssen, denn wir werden alle möglichen Communities brauchen in diesem Kampf. Wir werden nicht als kleine, selbstgerechte Gruppen kämpfen können, die dann vielleicht in ihren Blasen eine kleine Welt bauen. Wir wollen ja die grosse Welt besiegen und das ist unser Kampf.
[1]Dieses Flüchtlingslager befindet sich in Westbosnien, nahe der bosnisch-kroatischen Grenze. Es wurde 2020 errichtet, später aber aufgrund seines miserablen, menschenunwürdigen Zustands geschlossen. Petar Rosandić bezeichnete die von Österreich mitfinanzierte Gefängnisanlage im Camp als «österreichisches Guantanamo», woraufhin das in Wien ansässige ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) Rosandić anklagte. Dieser lächerliche, zu Abschreckungs- und Einschüchterungszwecken gedachte Prozess, verlor das ICMPD dann.