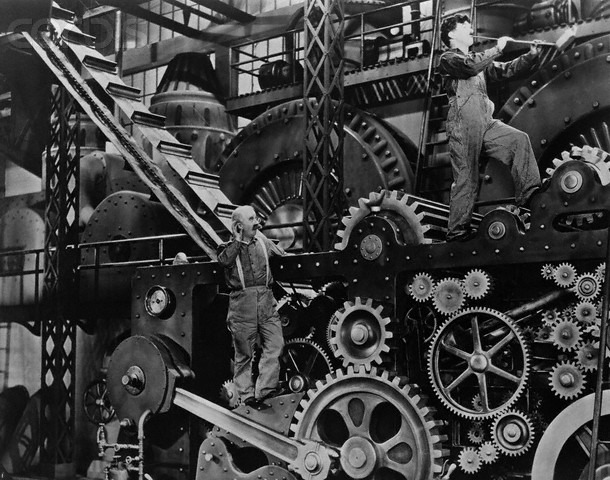Weltweit verschärfen sich seit Jahren die Angriffe der herrschenden Klasse auf unsere Arbeits- und Lebensbedingungen. Durch die Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank am 15. Januar 2015 wurde auch hierzulande eine neue Offensive ausgelöst, mit der die Unternehmer versuchen längst geplante Deregulierungsmassnahmen und weitere Angriffe auf unsere Löhne in die Tat umzusetzen. Diesen Angriffen von oben gilt es unseren kollektiven Widerstand von unten entgegen zu setzen.
von BFS Zürich
Flexibilität, Einsatzbereitschaft, lebenslanges Lernen und Selbst-Management, das seien die Voraussetzungen für das Anrecht auf ein gesichertes Einkommen, wird uns von neoliberalen Ideologen eingeprügelt. Wer sich nicht fit halte, sei selbst schuld, müsse sich mit den Brosamen zufrieden geben oder sei Parasit der Gesellschaft. Den Luxus eines Sozialstaates könne man sich nicht mehr leisten, Alternativen gäbe es keine – obwohl dieser Sozialdarwinismus von vielen Lohnabhängigen abgelehnt wird, obwohl sich in Südeuropa heftiger Widerstand gegen Sparmassnahmen und für ein Recht auf ein Einkommen formiert, so ist es doch diese Logik, welche die Arbeits- und Lebensrealität dominiert. Wie haben sich diese Realitäten verändert? Was zeichnet den Kapitalismus, die Arbeits- und Ausbeutungsverhältnisse des 21. Jahrhunderts aus? Wo gibt es Ansatzpunkte für erfolgreichen Widerstand gegen die permanenten Angriffe auf die Lohnabhängigen?
Europa steckt heute in der tiefsten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise seit den 1930er Jahren. Nachdem in Europa bis zu den 70er Jahren im Kontext des Wiederaufbaus und des Kalten Krieges diverse soziale Reformen erkämpft (und ausgehandelt) wurden, sind die letzten 30 Jahre von neoliberalen Konterreformen geprägt. Die Verlagerung der industriellen Produktion in sogenannte „Schwellenländer“ Südostasiens und nach China führte zu einer teilweisen Desindustrialisierung in Europa und den USA. Die rückläufige Kaufkraft wurde vor allem in den USA mit massiven Kreditvergaben überbrückt, um eine (globale) Überproduktionskrise hinauszuzögern, was schliesslich 2008 zum Kollaps des US-Immobilienmarktes und zum Bankrott der US-Bank Lehman Brothers führte und das Weltfinanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs brachte.
Die gleichen Rating-Agenturen, welche 2008 keine Risiken in den Kreditvergaben der Banken feststellten, lösten mit ihrer Abwertung der Kreditwürdigkeit südeuropäischer Staaten die nächste Stufe der aktuellen Weltwirtschaftskrise aus. Während 2008 von vielen Staaten massiv Geld ins Finanzsystem gepumpt wurde, wird die „Schuldenkrise“ in Südeuropa zur Umsetzung von knallharten Strukturreformen gegen die ArbeiterInnen, RentnerInnen, Arbeitslosen usw. benützt. Der europäische Fiskalpakt zwingt jede Regierung zu eisernem Sparen und zur Einrichtung einer Schuldenbremse, die „bindend, dauerhaft und nicht durch parlamentarische Mehrheiten zu kippen ist“, wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte. Die Europäische Union agiert hier also als Inkassobüro für das Finanzkapital welches u.a. billige Kredite von der EZB bekommt und zu hohen Zinsen an die betroffenen Staaten weiter vergibt. Diese von der Troika (europäische Zentralbank, IWF und EU-Kom-mission) aufgezwungenen Massnahmen – Sparprogramme, Euro-Rettungsfonds, Fiskalpakt – haben die Krise nicht gelöst, sondern verschärft, weil den Staaten durch Zinszahlungen viele Mittel entzogen wurden und die Kaufkraft der Menschen massiv sank.
Was die europäische Bourgeoisie als zwingende Notwendigkeit zur Stabilisierung der europäischen Währung darstellt, sind permanente und immer neue Angriffe auf die ArbeiterInnenklasse. Ziel dabei ist es, auf dem Weltmarkt wieder konkurrenzfähiger zu werden und eine Reindustrialisierung Europas mit einer Anpassung der Arbeitsbedingungen, der Löhne, aber auch des Soziallohns nach unten zu erreichen. Letzteres bedeutet, dass die Arbeitgeber-Kosten für Sozialversicherungen, aber auch Steuerausgaben für öffentliche Dienstleistungen reduziert werden sollen und so die anfallenden Kosten pro Arbeitsstunde reduziert werden.
Obwohl diese Angriffe in Südeuropa härter und offensiver stattfinden, sind die Lohnabhängigen in der Schweiz ebenfalls von dieser internationalen In-Konkurrenz-Setzung und von Lohndumping betroffen: Einerseits hat die Personenfreizügigkeit in Europa zu einem grossen Nachschub an Arbeitskräften geführt und in vielen Sektoren nivellieren sich die Löhne auf dem gesetzlichen Minimum, anderseits gibt es vielfältige Mechanismen – z.B. Werkverträge – wie solche sektoriellen und regionenspezifischen Mindestbedingungen umgangen werden können.
Die BFS Zürich veranstaltet im Mai und Juni 2015 einen Diskussionszyklus zur “Veränderung der Arbeit und ihre Bedeutung für die politische Intervention”. An vier verschiedenen Veranstaltungen wollen wir auf die Veränderungen der Arbeitswelt und die Verschlechterung unserer Arbeits- und Lebensbedingungen eingehen. Gemeinsam möchten wir versuchen, Perspektiven zu entwickeln, die in eine andere Richtung gehen und die Bedürfnisse von uns Lohnabhängigen – und nicht die Profite der Unternehmer – ins Zentrum der Diskussionen um Arbeit, Arbeitsbedingungen und Produktion stellen.
Veranstaltungen des Diskussionszyklus:
Donnerstag, 7. Mai 2015: Arbeit und Gesundheit
Dienstag, 19. Mai 2015: Reindustrialisierung
Donnerstag, 4. Juni 2015: Arbeit, Löhne und Profite
Donnerstag, 18. Juni 2015: Agenda 2010, Leiharbeit, Werkverträge