Glaubt man den Wirtschaftsressorts der bürgerlichen Presse, erleben wir eine Zeitenwende: «Uber, das grösste Taxiunternehmen der Welt, besitzt keine Fahrzeuge. Facebook, der beliebteste Medienkonzern der Welt, erstellt keine Inhalte. Alibaba, der wertvollste Einzelhändler, hat kein Lager. Und AirBnB, der weltgrösste Anbieter von Unterkünften, besitzt keine Immobilien. Hier passiert etwas Interessantes.»1 Die vierte industrielle Revolution möchte mit Rechenzentren, Glasfaser und Sensortechnik die menschlichen Sinne und schrittweise auch das Gehirn aus dem Produktionsprozess eliminieren. Stehen wir an der Schwelle zu einem voll automatisierten Wohlfühlkapitalismus? Was sind die Akteur*innen dieses digitalen Kapitalismus? Und wie wird die Arbeit aussehen, die noch übrig bleibt?
von Jakob Späth und Raphael Liebermann (BFS Zürich)
Die Geburt des digitalen Kapitalismus
Bei einem Blick auf die Hauptakteur*innen des digitalen Kapitalismus fallen zwei Dinge ins Auge: Zum einen haben die dafür zentralen Unternehmen vor zwanzig Jahren noch nicht existiert oder haben es innerhalb dieser Zeit geschafft, ihr Kapital und ihre Marktmacht massiv auszubauen. Zum anderen handelt es sich um global agierende Konzerne, die für sich selbst eine Führungsrolle im Umbau des kapitalistischen Wirtschaftssystems beanspruchen. Um diese beispiellose Akkumulation und ihre Auswirkung auf das alltägliche Leben und die Gesellschaft zu verstehen, hilft es, die bisherige Entwicklung genau anzuschauen:
Der in den 1970er Jahren ausgebrochenen Produktions- bzw. Überakkumulationskrise begegnete die Bourgeoisie und die Regierungen der industriellen Zentren mit einem Angriff auf den Sozialstaat und die Organisationen der Arbeiter*innenklasse. Zusammen mit der Automatisierung führte dieser Angriff zum Anwachsen einer armen Gesellschaftsschicht, die gar nicht oder nur gelegentlich unter prekären Bedingungen beschäftigt ist. In Lohnverhandlungen werden diese Menschen als Druckmittel genutzt: Wer mit dem gebotenen Gehalt nicht zufrieden ist, kann durch andere Arbeitssuchende ohne grosse Probleme ersetzt werden. Gleichzeitig wurde durch die Öffnung und marktkonforme Umgestaltung der Bildungssysteme dafür gesorgt, dass dieser Teil der Bevölkerung nicht nur die ungelernten Industriearbeiter*innen sondern auch die Angestellten im Dienstleistungssektor unter Lohndruck setzen konnte. Zu Beginn der Entwicklung des digitalen Kapitalismus steht also ein gut gefülltes Reservoir günstiger und gut ausgebildeter Arbeitskraft zur Verfügung.
Diese Massnahmen waren aber bei weitem nicht ausreichend, die Produktion wieder so rentabel zu machen, dass sich der gesamtgesellschaftlich erwirtschaftete Mehrwert komplett darin hätte reinvestieren lassen. Seither fliesst ein immer grösserer Teil der Gewinne in die Finanzmärkte. An den Börsen kann er über den Globus verteilt und an profitable Unternehmen – in den letzten Jahren waren dies vor allem die Konzerne des Silicon Valley – verliehen werden. Das verliehene Kapital muss wiederum gewinnbringend angelegt werden, da die Kapitalbesitzer*innen ihre Profite in Form von Zinsen erwarten.2 Ein beträchtlicher Teil des Kapitals an den Finanzmärkten stammt aus den durch den Sozialstaatsabbau stark gewachsenen Altersvorsorge-Fonds.
Das dritte und letzte Standbein des digitalen Kapitalismus sind die Ergebnisse jahrzehntelanger Forschung in der Mikroelektronik und der Informationstechnologie sowie der Aufbau eines globalen Kommunikationsnetzes. Erst die Entwicklung von Mikrochips mit ausreichend hoher Rechenleistung und Effizienz liess die flächendeckende Verbreitung tragbarer Kleinstrechner zu, ohne die die Sammlung, Übermittlung und Verarbeitung von Daten und damit die Plattformen des digitalen Kapitalismus undenkbar wären.
Plattform, Algorithmus und künstliche Intelligenz
Die grundlegende Funktion einer Plattform ist die Sammlung und Verarbeitung von Daten zur Steuerung des Arbeits-, Verkaufs- oder Produktionsprozesses. Hierzu werden in der Regel künstliche Intelligenzen verwendet, also Programme, die nicht von Hand für eine bestimmte Aufgabe programmiert werden, sondern die mit einigen wenigen Zielvorgaben anhand von Daten dazu trainiert werden, bestimmte Aufgaben selbstständig zu erfüllen. Klassische Beispiele hierfür sind die Erkennung von Handschriften, die Erkennung von Bildern oder das Fällen taktischer Entscheidungen. Aber auch die Reihenfolge, in der Suchmaschinen ihre Ergebnisse anzeigen, oder die Vorschläge, welchen Accounts man in sozialen Netzwerken folgen könnte, werden von solchen selbstlernenden Algorithmen bestimmt. In Zukunft sollen sie auch eigenständig und unüberwacht Autos fahren, Verwaltungsaufgaben übernehmen oder Krankheiten diagnostizieren.
Der Wettbewerb im Digitalen wird vor allem durch die Zuverlässigkeit des verwendeten Algorithmus bestimmt – und die hängt direkt von der Menge der Daten ab, mit denen er trainiert wurde. Um an diese Daten zu kommen, wird das Verhalten sämtlicher Nutzer*innen und alles, was sie auf den entsprechenden Plattformen hochladen, automatisch aufgezeichnet, kategorisiert und analysiert. Jeder Klick bei Amazon ist Marktforschung, jede Standortweitergabe an Google verbessert die Staumeldung bei Google Maps und wenn Millionen von Menschen bei der #TenYearChallenge ein aktuelles und ein zehn Jahre altes Bild von sich auf Twitter oder Instagram veröffentlichen, kann man getrost davon ausgehen, dass diese Bilder in das Training einer Gesichtserkennungssoftware einfliessen werden.
Die Verarbeitung der gesammelten Daten zu brauchbaren Trainingssets benötigt allerdings häufig noch menschliche Arbeit. Um beispielsweise eine Schrift- oder Bilderkennungssoftware zu trainieren, werden gerne sogenannte «Clickworker» herangezogen, die dann für einen lächerlich geringen Stücklohn mechanisch einzelne Wörter entziffern oder Bilder nach bestimmten Gesichtspunkten kategorisieren und verschlagworten. Allerdings helfen auch hier in manchen Fällen die Nutzer*innen – mehr oder weniger freiwillig – kostenlos aus: da verschiedene Dienste sich gegen übermässige maschinelle Nutzung schützen möchten, verwenden sie kleine Aufgaben, die für Algorithmen (noch) schwer lösbar sind, den meisten Menschen aber keine Probleme bereiten. Und wenn man Nutzer*innen sowieso schon dazu zwingen muss, kleinste Aufgaben zu verrichten, kann man sie auch gleich etwas Nützliches tun lassen: vor etwa zehn Jahren, als verschiedene Unternehmen an der Verbesserung ihrer Texterkennungssoftware arbeiteten, bestanden die meisten dieser Aufgaben aus der Entzifferung einzelner Wörter. Mittlerweile ist Google, das seit etwa zehn Jahren an der Entwicklung autonomer Fahrzeugsteuerung arbeitet, dazu übergegangen, Nutzer*innen Bilder mit Ampeln, Bussen und Fussgängerwegen markieren zu lassen.
Geschäftsmodelle
Die derzeit gängigen Plattformen des digitalen Kapitalismus lassen sich in fünf Typen einteilen: Werbeplattformen wie Google oder Facebook, die die gesammelten Daten dazu nutzen, um die Wirksamkeit der angezeigten Werbung zu erhöhen; Cloud-Plattformen wie Amazon Web Services oder Salesforce, die digitale Infrastruktur vermieten oder verkaufen; Industrieplattformen wie Siemens’ MindSphere oder General Electrics Predix, die Digitalisierungslösungen für Industriebetriebe anbieten; Produktplattformen wie Spotify, die Abonnements für alle möglichen materiellen und immateriellen Güter anbieten; und schlussendlich schlanke Plattformen wie Uber, Foodora oder Amazon Mechanical Turk, die sich als reine Vermittlerinnen zwischen Anbieter*innen bzw. Produzent*innen und Konsument*innen verstehen.3
Die Wirtschaftsweisen der fünf Typen haben einige Gemeinsamkeiten: Durch die Sammlung und Auswertung von Daten sind sie in der Lage, Angebot und zahlungskräftige Nachfrage zielgerichteter zusammenzubringen und individualisierte Angebote zu machen. Die computergestützte Steuerung des Arbeitsablaufs und der Distribution ermöglicht eine Verkürzung der Zeit zwischen Produktion und Konsum, führt also zu einer intensiveren Ausbeutung der Arbeitskraft und damit zu einer Profitsteigerung.
Wie schon bei früheren technischen Neuerungen im Produktionsprozess führt dies zu einer Intensivierung des Arbeitsprozesses und einer Anpassung der Arbeiter*innen an die Maschine bzw. die Plattform und deren Algorithmen. Vormals schwer mess- und überwachbare Aufgaben werden in immer kleinere Einzelschritte unterteilt, deren Erfüllung entweder direkt durch Sensoren gemessen oder durch die Arbeiter*in ständig bestätigt werden muss. Dies erinnert an die Zerlegung von Fertigungsprozessen in einzelne, genau getaktete Handgriffe in der Fliessbandarbeit. Benötigt ein Unternehmen zum Training eines Bilderkennungsalgorithmus einen grösseren verschlagworteten Datensatz von Bildern, erhalten einzelne Clickworker*innen einen Stapel Bilder, die sie dann nach einem einzigen Merkmal kategorisieren müssen; etwa, ob auf dem Bild ein Hydrant zu sehen ist. Auch die Auslieferung von Essen wird entsprechend getaktet: die Lieferung wird in die Schritte «Annahme des Auftrags», «Ankunft im Restaurant», «Annahme der Lieferung», «Ankunft an der Lieferadresse» und «Abgabe der Lieferung» unterteilt, die jeweils einzeln in der App bestätigt werden müssen.
Da jedoch nur die menschliche Arbeit und die Ausbeutung der Natur in der Lage sind, tatsächlich Mehrwert zu schaffen und digitale Infrastruktur mit fortschreitender Entwicklung immer günstiger wird als menschliche Arbeitskraft, erzeugt ein immer kleinerer Teil des Gesamtkapitals noch Mehrwert. Dies führt dazu, dass ein immer grösseres Interesse daran besteht, mehr Profit durch Lohnsenkung, Verlängerung der Arbeitszeit und Intensivierung der Arbeit zu erzielen.
In sämtlichen Bereichen des digitalen Kapitalismus zeichnet sich eine starke Entwicklung hin zu Monopolen ab. Dies wird durch zweierlei Faktoren begünstigt: Zum einen ist es den Unternehmen möglich, sich sehr günstig mit Fremdkapital zu versorgen und damit ihre Dienste bis zur Erringung eines Monopols mit teils massiven Verlusten günstig bis kostenlos anzubieten, um weniger kapitalstarke Konkurrenz auszustechen. Zum anderen greifen sogenannte Netzwerkeffekte: Eine Plattform ist umso nützlicher, je mehr Nutzer*innen sie hat (es lohnt sich nicht, auf Google+ Werbung zu schalten, wenn das von niemandem genutzt wird; eine Plattform für Essenslieferdienste, auf der nur fünf Restaurants vertreten sind, wird kaum Nutzer*innen begeistern können). Während bei Unternehmen, die im physischen Raum agieren, die Zahl der möglichen Kund*innen räumlichen Beschränkungen unterliegt (an bestehende Gebäude kann man nur begrenzt häufig anbauen, bevor sich eine Nachbar*in oder die Baubehörde beschwert), sind diese im Digitalen zumindest teilweise aufgehoben: Es ist ohne weiteres möglich, zusätzliche Serverkapazität anzumieten oder eigene grosse Serverkomplexe ins Nirgendwo zu bauen, weil der physische Speicherort der Daten und die Interaktion mit den Arbeiter*innen, Kund*innen oder Nutzer*innen voneinander unabhängig sind. Ausserdem bedeuten mehr Nutzer*innen mehr verwertbare Daten, die dann wieder in die Verbesserung der Algorithmen fliessen können.
Hat ein Konzern einmal eine Monopolstellung im Plattformkapitalismus erreicht, ist es fast unmöglich, eine konkurrenzfähige Alternative im selben Sektor aufzubauen. Monopole erhalten sich selbst. Dies liegt zum einen daran, dass die Monopolunternehmen zusammen mit dem Staat die gesetzlichen Auflagen so gestalten können, dass das notwendige Startkapital für ein potenzielles Konkurrenzunternehmen ins Unermessliche steigt. Zum anderen können die Monopole kleine Firmen derselben Branche einfach aufkaufen, sobald sie gross genug sind. Dieses Phänomen der Start-up-Firmen kommt den Monopolisten sogar sehr gelegen, da sie die Entwicklung von Innovationen und das damit verbundene Risiko an die Start-ups auslagern können, in denen unter prekären Bedingungen an neuen experimentellen Projekten gearbeitet wird. Nur die Ideen, die sich am Markt bewähren, werden durch die Monopolisten geschluckt.
Die Konzerne sind für dieses defizitäre Wachstum auf einen ständigen Zustrom von Kapital aus den Finanzmärkten angewiesen. In Ermangelung sicherer Anlageoptionen sind Investor*innen gleichzeitig genötigt, auf die zukünftige Monopolrendite der digitalen Konzerne zu spekulieren. Dies hat den Effekt, dass in Unternehmen mit viel Kapital noch mehr Kapital investiert wird, da diese die grössten Chancen haben, eine Monopolstellung zu erreichen, und damit die erhoffte Monopolrendite wahrscheinlicher wird. Die Überakkumulation im Rest der Wirtschaft also bewirkt eine noch schnellere Monopolbildung im fürs Erste unrentablen digitalen Sektor.
Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen
Eine der wichtigsten Stellschrauben, um die Preise niedrig und gleichzeitig den Verlust gering zu halten, ist die Verringerung des Preises der «Ware Arbeitskraft». Das erste Werkzeug, dem sich viele Plattformen bedienen, ist die Fiktion, dass die Menschen, die die angebotene Arbeitsleistung erbringen, keine Angestellten des Unternehmens sind – es handle sich um freie Unternehmer*innen, die Plattform vermittle bloss zwischen Angebot und Nachfrage, sei also nichts als ein Marktplatz. Der Vorteil dieses Konstruktes liegt auf der Hand: Für freie Unternehmer*innen entfallen keine Sozialabgaben, sie haben kein Anrecht auf Mindestlöhne, Urlaub oder gewerkschaftliche Organisation und auch die für die Erfüllung der Aufträge notwendigen Produktionsmittel müssen nicht vom Plattformanbieter gestellt werden. Ausserdem verfängt diese Interpretation des Arbeitsverhältnisses auch bei den Arbeiter*innen der Plattformen: Man freut sich über die Möglichkeit, frei wählen zu können, ob und wann man arbeitet, und vergisst darüber, dass man häufig mehr als die Regelarbeitszeit für ein Gehalt weit unter dem Mindestlohn arbeitet.
Das andere Werkzeug ist die vielfältige Intensivierung der Arbeit. Viele Plattformen setzen auf einen Stücklohn und kehren damit zu «der kapitalistischen Produktionsweise entsprechendste[n] Form des Arbeitslohns»4 zurück, die für das Unternehmen die Vorteile hat, dass Leerlaufzeiten nicht bezahlt werden müssen, und dass sie die Arbeitsgeschwindigkeit automatisch erhöht.
Bei der Vergabe von Aufträgen bzw. Arbeitsschichten greifen viele Unternehmen auf sogenannte «Reputationssysteme» zurück: Aus erfassten Daten (z.B. Zufriedenheit der Kund*innen, Zeit, die arbeitsbereit auf der Plattform verbracht wird, Geschwindigkeit bei der Erledigung von Aufgaben) werden Werte berechnet, aufgrund derer neue Aufträge vergeben werden. Auf den klassischen Clickwork-Plattformen werden lukrativere Aufgaben an häufiger und länger auf den Plattformen aktive Clickworker*innen vergeben, während die Schichtvergabe bei Essenslieferdiensten in der Regel in Etappen erfolgt: die schnellsten, flexibelsten und zuverlässigsten Fahrer*innen, die am meisten arbeiten, können sich die einträglichsten Schichten unter den Nagel reissen, die Langsameren und weniger Flexiblen müssen sich mit den schlechteren Schichten begnügen.
Die Reputationswerte sind ausserdem die Grundlage einer «Gamification» der Arbeit, bei der den Arbeiter*innen regelmässig nahegelegt wird, ihre Reputationswerte zu verbessern. Die Arbeit wird so zu einem Spiel gemacht, bei dem sämtliche Arbeiter*innen der Plattform gegeneinander antreten. Die Essenslieferdienste beispielsweise senden ihren Fahrer*innen wöchentlich Zusammenfassungen ihrer Statistiken mit ihrem aktuellen Rang unter allen Fahrer*innen und Hinweisen, an welchen speziellen Parametern sie gezielt arbeiten könnten. Ausserdem bieten viele Plattformen digitale Auszeichnungen für die Erfüllung bestimmter Kriterien (sogenannte Achievements) an, die diese dann auf ihren Profilen auf der Plattform zur Schau stellen können.
Zuletzt bedienen sich einige Plattformen zeit- oder ergebnisbasierter Wettbewerbe, bei denen der gleiche Auftrag an verschiedene Arbeiter*innen vergeben wird und nur das schnellste oder am Ende von den Kund*innen gewählte Produkt vergütet wird.
Der digitale Kapitalismus in der Krise
Die Frage stellt sich, ob all diese Entwicklungen den Kapitalismus krisenfreier machen werden. Die computerisierte Planung und Durchführung der Produktion wird mit weniger Arbeitskraft auskommen, während die Zeit zwischen der Produktion einer Ware oder einer Dienstleistung und ihrem Konsum weiter verkürzt wird. Beides hat das Potenzial, das Volumen der globalen Wirtschaft noch einmal massiv zu steigern. Und hier rennt der Kapitalismus in eine bekannte Sackgasse.
Die Kapitalmenge, die nach einer gewinnbringenden Anlagemöglichkeit sucht, wird weiterwachsen. Gleichzeitig wird der Masse an Gütern verhältnismässig immer weniger Kaufkraft gegenüberstehen. Die Dynamiken, die zum Entstehen des digitalen Kapitalismus geführt haben, setzen sich verstärkt fort. Weitere Überproduktions- bzw. Überakkumulationskrisen sind nur eine Frage der Zeit. Wenn die Warenproduktion und der Warenkonsum, welche die Basis des Finanzmarktes bilden, ins Stocken geraten, werden Blasen platzen und das investierte Kapital wird an Wert verlieren.5 Die digitalen Konzerne sind sehr abhängig vom Finanzkapital und können dementsprechend auch starke Wertverluste erleiden.
Aber auch während einer Konjunktur steht der digitale Kapitalismus auf sehr wackeligen Beinen. Denn alles, worauf er sich stützt – die Daten, Programme und die KI –, können ohne nennenswerten Arbeitsaufwand vervielfältigt und um die ganze Welt geschickt werden. Je mehr Arbeit in die Entwicklung dieser Programme fliesst, desto höher wird auch der Anreiz, diese Software «illegal» zu vervielfältigen. Ihre Besitzansprüche zu sichern und gegen die Interessen der Nutzer*innen zu verteidigen, wird eine grösser werdende Herausforderung für diese Konzerne sein. In Zukunft werden wir vermutlich eine viel striktere Verfolgung von Verstössen gegen das Urheberrecht erleben.
Was ist aber mit den Arbeitsplätzen? Der Konjunkturschub der digitalisierten Produktion wird mit dem Einsatz von mehr Technologie und weniger menschlicher Arbeitskraft einhergehen. Auch hier wird sich der Trend fortsetzen, dass das Wachstum der Industrie relativ immer weniger Menschen Lohnarbeit bieten kann.6 Gleichzeitig wird durch die «Digitalisierung» der bestehenden Sektoren sehr viel menschliche Arbeit überflüssig werden.
Die «Digitalisierung» der Arbeitswelt wird also für viele eine Welt ohne Lohnarbeit bedeuten und für eine immer kleiner werdende Gruppe eine sich intensivierende Ausbeutung, mehr Stress und Burn-Out. Bisher wurde der soziale Frieden, welcher dieses allumfassende Ausbeutungsverhältnis übertüncht, in Form des Sozialstaats durch Sozialabgaben querfinanziert. Was passiert aber mit dem Sozialstaat, wenn es immer weniger Lohnabhängige und immer mehr Arbeitslose gibt? Unser Sozialsystem wird sich verändern müssen. Auch die Gewerkschaften stehen vor einer existenziellen Herausforderung. Sie rekrutieren sich zurzeit aus festangestellten Lohnabhängigen. Wie oben beschrieben, werden deren Arbeitsplätze langfristig nicht zu erhalten sein. Die Frage ist, wie Arbeitskämpfe in Betrieben mit nur wenigen Arbeiter*innen aussehen werden. (Es muss betont werden, dass es keine genauen und eindeutigen Prognosen für die Anzahl der Arbeitsplätze gibt. Das Entstehen eines neuen Sektors, vergleichbar mit der Kommerzialisierung der Computertechnologie, könnte den Trend der sinkenden Anzahl der Arbeitsplätze zeitweilig umkehren.)
Der Kapitalismus der digitalen Konzerne ist weiter sehr energiehungrig. Alle Rechenzentren verbrauchten im Jahr 2016 zusammen 3% des weltweit verfügbaren Stroms. Bei einer derzeitigen Verdoppelung des Bedarfs alle vier Jahre würde ihr Anteil im Jahr 2025 auf 20% steigen.7 Da der Kapitalismus seine Energie immer noch zu mehr als 70% aus fossilen Brennstoffen bezieht, verursachen die digitalen Konzerne sehr viele Treibhausgasemissionen. Dies ist angesichts der Klimakrise nicht tragbar.
Zudem sollten wir uns vom Buzz-Word «Digitalisierung» nicht verwirren lassen. In diesem Artikel ging es vorwiegend um Bits und Bytes, der digitale Kapitalismus benötigt jedoch eine handfeste Infrastruktur. Die Computer in den Rechenzentren, die riesigen omnipräsenten leuchtenden Bildschirme, die Akkus unserer Smartphones, sie alle bestehen aus Metallen, von denen es auf unserer Erde nur eine begrenzte Menge gibt. Schätzungen zufolge haben wir bereits mehr als die Hälfte des uns verfügbaren Kupfers und Kobalts aus der Erde geholt.8 Der digitale Kapitalismus geht mit einem nie dagewesenen Ausmass an zerstörerischer Ausbeutung von Kohle, Lithium, Kupfer und seltenen Erden einher. Dieses Mass an Umweltzerstörung bringt die Ökosysteme an den Rand des Kollapses.
Der digitale Kapitalismus macht uns zu gläsernen Konsument*innen und fordert uns zum Kampf um den Schutz unserer Daten heraus. Denn schon heute kollaborieren Technologiekonzerne mit repressiven Überwachungsstaaten und verwenden unsere Daten gegen uns. Eine emanzipatorische, antikapitalistische, revolutionäre Politik wird immer nötiger. Ihr gegenüber steht eine Phalanx aus digitalen Monopolen und dem Überwachungsstaat. Die segensreichen Versprechen der digitalisierten Wirtschaft werden sich als hohle Phrasen entlarven. Die «Digitalisierung» weist nicht den Weg in eine neue Gesellschaft, sie ist vielmehr eine gesteigerte Form der jetzigen untragbaren Zustände. Es wird daher Zeit, dass der Kampf gegen die digitalen Konzerne von technischen Bedenken hin zu antikapitalistischen Alternativen und von Internetforen auf die Strasse verlagert wird.
1 Goodwin (2015). «Uber, the world’s largest taxi company, owns no vehicles. Facebook, the world’s most popular media owner, creates no content. Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory. And Airbnb, the world’s largest accommodation provider, owns no real estate. Something interesting is happening.» https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface
2 Harvey (2017). Marx, Capital and the Madness of Economic Reason, Oxford Press
3 Für eine genauere Betrachtung der Plattformtypen und ihrer Geschäftsmodelle empfiehlt sich die Lektüre von Srnicek 2017.
4 MEW 23: 580.
5 Kosmoprolet 2 (2009); Krise des Werts
6 Kosmoprolet 4 (2015); Krise der Reproduktion
7 Mahnkopf (2019); Grüner, produktiver, friedlicher? (Teil 2); Blätter für deutsche und internationale Politik 11/19
8 Ebenda

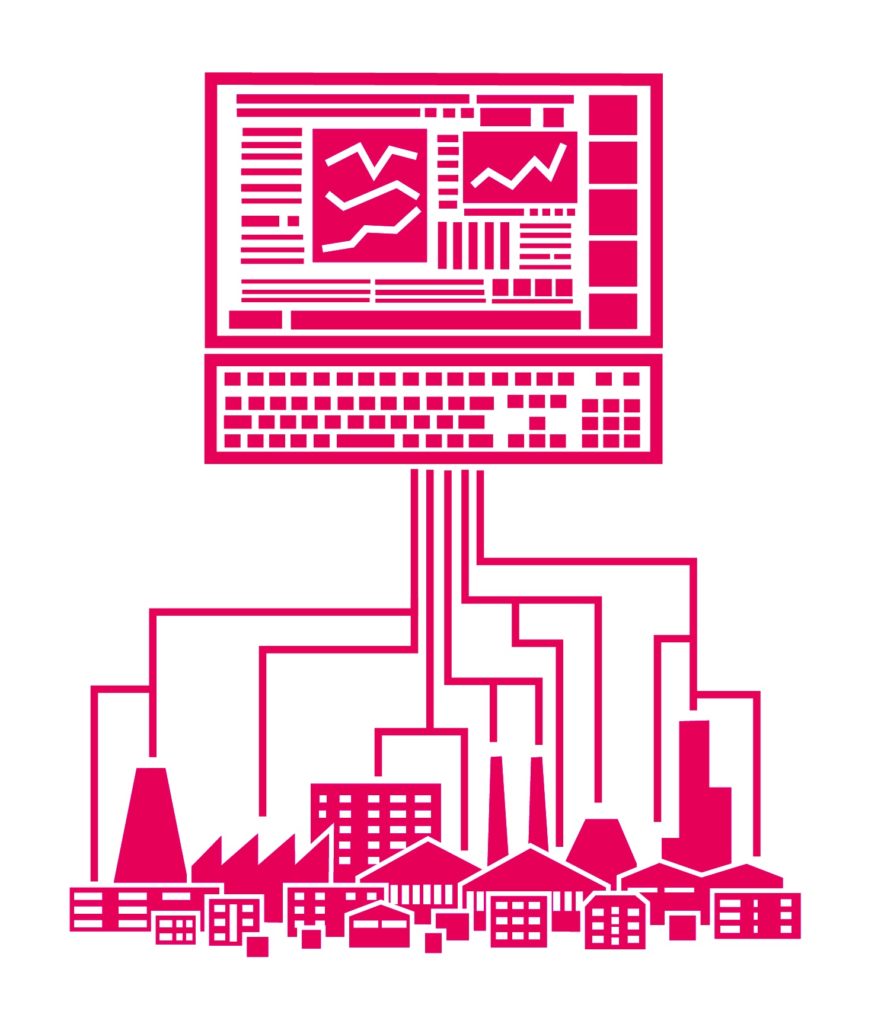



Dieses Themenfeld beleuchten wir in Basel an einem Festival Ende September 2024 am „hack the promise festival“: https://hackthepromise.org/. Wir freuen uns auf zahlreiche TeilnehmerInnen.