Ohne Strom ist unser modernes Leben nicht mehr denkbar. Alles braucht Strom, von offensichtlichen Verbrauchern wie Smartphones und Lampen über Elektroheizungen bis zu Minicomputern, die z.B. eine Gasheizung steuern. Fast jeder Aspekt unseres Lebens ist von Strom abhängig und Strom ist dadurch zu einem Grundbedürfnis geworden. Und wie bei allen Grundbedürfnissen hat eine Liberalisierung der Versorgung besonders verheerende Auswirkungen, auch mitten in Westeuropa.
von Peter Hänggli (BFS Basel); aus antikap
Die Geschichte der modernen
Stromnetze Die Anfänge der heutigen Stromnetze wurden in Europa nach dem 2. Weltkrieg aufgebaut, als in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg der Strombedarf rasant anstieg. Dazu wurden staatliche Unternehmen gegründet, die Kraftwerke sowie Verteilnetze bauten. Damit ein Stromnetz funktioniert, muss der Strom im System eine stabile, gleichbleibende Frequenz (in Europa 50Hz) haben. Dies wird erreicht, indem sich Produktion und Verbrauch die Waage halten. Mittels sogenanntem Regelstrom wird die Frequenz bei Schwankungen (z.B. durch den Ausfall eines Kraftwerkes) stabilisiert, indem Produktion zu- oder abgeschaltet wird. Die Stromproduktion mittels Atomkraftwerken oder die Verbrennung fossiler Energieträger hat den Vorteil, dass sie relativ präzise regulierbar ist. Deren grosser Nachteil sind jedoch die bei der Umwandlung in Strom entstehenden Abfallprodukte – wie CO2 oder strahlende Brennstäbe –, welche grosse Schäden für das Klima zur Folge haben. Erneuerbare Energiequellen wie Wind-, Solar- oder Wasserkraft sind besser für das Klima, sind aber auch stark vom Wetter abhängig und liefern manchmal zu viel und manchmal zu wenig Energie. Um dies auszugleichen, muss zu Zeiten hoher Produktivität die Energie gespeichert und zu Zeiten niedriger Produktivität wieder abgerufen werden.

Strom kann allerdings in grossen Mengen nur sehr schwer gespeichert werden. Eine der wenigen etablierten Methoden sind sogenannte Pumpspeicherwerke, Speicherseen an erhöhter Lage in den Bergen. Wenn mehr Strom produziert als verbraucht wird, wird damit Wasser den Berg hinauf in den Stausee gepumpt, wenn mehr Strom verbraucht wird, fliesst das Wasser durch die Schwerkraft getrieben wieder hinunter und treibt dabei Turbinen an, welche Strom produzieren. Ein grossflächiges Stromnetz macht es einfacher, regionale Schwankungen bei Verbrauch und Produktion auszugleichen. Durch ihre geographische Lage in der Mitte Westeuropas und ihre vielen Pumpspeicherwerke in den Bergen hat die Schweiz eine zentrale Funktion im europäischen Stromnetz, welches auch in der Schweiz geboren wurde: Mit der als «Stern von Laufenburg» bekannten Schaltanlage wurde 1958 im Aargau erstmals die Stromnetze von Deutschland, Frankreich und der Schweiz miteinander verbunden.
Der Hintergrund der aktuellen «Energiekrise»
In ganz Europa steigen aktuell die Strompreise massiv. Begründet wird dies in den Medien vor allem mit dem Krieg in der Ukraine. Der Krieg und die Sanktionen gegen Russland erhöhen den Preis von Erdgas stark. Man würde also annehmen, dass der Preis für mit Gas hergestelltem Strom steigt, während vom Krieg nicht beeinflusste Energiequellen gleich teuer bleiben. In der Schweiz ist der Anteil des Gases an der Stromproduktion sehr klein, trotzdem steigen die Preise. Dies liegt laut der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom daran, dass der Strom nicht direkt aus der lokalen Produktion in die lokalen Netze gelangt, sondern von den Anbietern auf dem Strommarkt eingekauft wird.
Der Strommarkt
Aber was ist der Strommarkt eigentlich? Die Stromproduktion und Verteilnetze wurden zwar von der öffentlichen Hand erstellt, jedoch ab den 80er Jahren immer mehr liberalisiert und privatisiert. Margaret Thatchers England war das erste Land, das 1984 das öffentliche Strommonopol aufhob. Nach einer Richtlinie der EU-Kommission von 1996 stürzten sich auch die anderen europäischen Länder auf diesen neoliberalen Weg: Zunächst durch die Abschaffung des Import- und Exportmonopols; dann des Monopols für die Stromerzeugung und -Versorgung. Schliesslich musste auch das Verteilnetz durch eine Mautgebühr für den Wettbewerb geöffnet werden. So können nun private oder wie private funktionierende (die AXPO als grösster Schweizer Energiekonzern ist z.B. im Besitz der Kantone, wirtschaftet aber wie ein privatwirtschaftlich geführter Betrieb) Betreiber:innen die bestehenden Übertragungsnetze nutzen und sich gleichzeitig die hohen Investitionen für die Stromübertragung sparen. Die von öffentlichen Konzernen mit Steuergeldern errichtete Infrastruktur (Stromleitungen, Kraftwerke, Transformatoren) wird ohne eigene Investitionen und Instandhaltungskosten genutzt, um sich ausschliesslich um den lukrativen Handel mit Strom zu kümmern. Dieses Modell wurde von Thatcher beworben, indem der damalige Strompreis als Obergrenze festgelegt wurde. Der freie Markt könne also die Preise nur senken, nicht erhöhen. Ausserdem wurde die Bevölkerung mit Anteilen an den privatisierten Energieunternehmen besänftigt, welche bald danach von denselben Oligarch:innen aufgekauft wurden, die auch die Energieunternehmen gekauft hatten. Als Nächstes kam dann das Argument, dass so eine Obergrenze ja nicht einfach von Politiker:innen festgelegt werden könne, das müsse auch der Markt regeln. Ein echter Markt für Strom ist aber aufgrund der Infrastruktur nicht möglich, da es für eine echte Wahl des Konsumenten von jedem Anbieter eine eigene Leitung bräuchte.
Stattdessen wurde ein Markt simuliert, in dem das Elektrizitätssystem in 3 Teile geteilt wurde:
1. Produktion: Jede Produktionsanlage wird zu einem eigenen Unternehmen oder Teil eines Unternehmens und tritt dann in Wettbewerb mit anderen Produktionsunternehmen, um einen Grosshandelspreis zu bieten.
2. Betrieb: Netzwerk, worüber der Strom transportiert wird. Die Netzbetreiber kaufen den Strom von den Produzenten zu den Grosshandelspreisen.
3. Anbieter: Energieanbieter, die den Strom von den Netzbetreibern kaufen und an die Endkunden verkaufen.
Strom-Auktionen
An Strombörsen bieten die Produzenten per Auktion Strom an. Im Gegensatz zu traditionellen Auktionen «gewinnt» aber der Anbieter mit dem höchsten Preis; und dieser Preis gilt dann für alle anderen Anbieter auch. Begründung dafür ist das sogenannte «Marginal Cost Pricing» (Grenzkostenpreis: ein Produkt kostet so viel, wie es kosten würde, eine zusätzliche Einheit zu produzieren, mit Material- und Arbeitskosten). In Bezug auf den Strommarkt bedeutet das, dass die Kilowattstunde (kWh) so viel kostet, wie die Grenzkosten der teuersten Produktionsmethode, die für die Deckung des Gesamtbedarfs des Marktes benötigt wird. Das bedeutet, dass eine kWh, die mittels Solarpanels (welche Grenzkosten nahe Null haben – wenn das Panel mal arbeitet, fallen für die Energie der Sonne keine Kosten an) erzeugt wird, gleich teuer ist wie eine, die mit Gas (dessen Beschaffungspreis aufgrund des Ukrainekrieges in die Höhe schiesst) produziert wird. Im Gegensatz zur Schweiz stehen zwar in Europa viele Gaskraftwerke für kurzfristige Stromerzeugung (z.B. von Regelstrom bei Schwankungen im Netz), mit diesem System spielt der konkrete Anteil für den Preis aber gar keine grosse Rolle.
Seit der Inkraftsetzung dieses Systems hat sich der Profit, also der Unterschied zwischen tatsächlichen Produktionskosten und dem Verkaufspreis für den Strom, verdreifacht. Wenn die Produktion teurer wird, z.B. wegen Gasknappheit aufgrund des Ukrainekrieges, erklärt dies steigende Preise, aber nicht steigende Profite. Wie die geneigte Leserschaft sicherlich festgestellt hat, ist selbst die hier geschilderte, stark vereinfachte Erläuterung des Systems ziemlich kompliziert. Dies liegt nicht an der Natur der Sache, so wie z.B. die Konstruktion einer Rakete oder die Regulierung der Stromspannung kompliziert ist. Das System ist gewollt verkompliziert, damit die schamlose Profitmaximierung nicht so offensichtlich wird. Ein so komplexes System kann dann auch in den gut zugänglichen Medien nicht innerhalb der Zeit, die man zum Sprechen bekommt, erklärt werden. Das Argument für Liberalisierung ist immer, dass grösserer Wettbewerb die Effizienz eines Systems erhöhe. Das Hauptziel im Kapitalismus ist aber Profitmaximierung: Wenn die Profite anderweitig gesteigert werden können, ist Effizienz nicht nur sekundär, sondern wird je nachdem, ob man damit noch mehr Profit machen kann, sogar aktiv gemindert. Konkretes Beispiel dafür: Grossbritannien, wo alles seinen Anfang nahm, könnte mit Wind-, Nuklear- und Gaskraft (Nordsee) genug Energie produzieren, um sich selbst zu versorgen. Grossbritannien wäre also gar nicht zwingend vom europäischen Strommarkt abhängig. Trotzdem leidet die britische Bevölkerung momentan unter extrem gestiegenen Kosten.
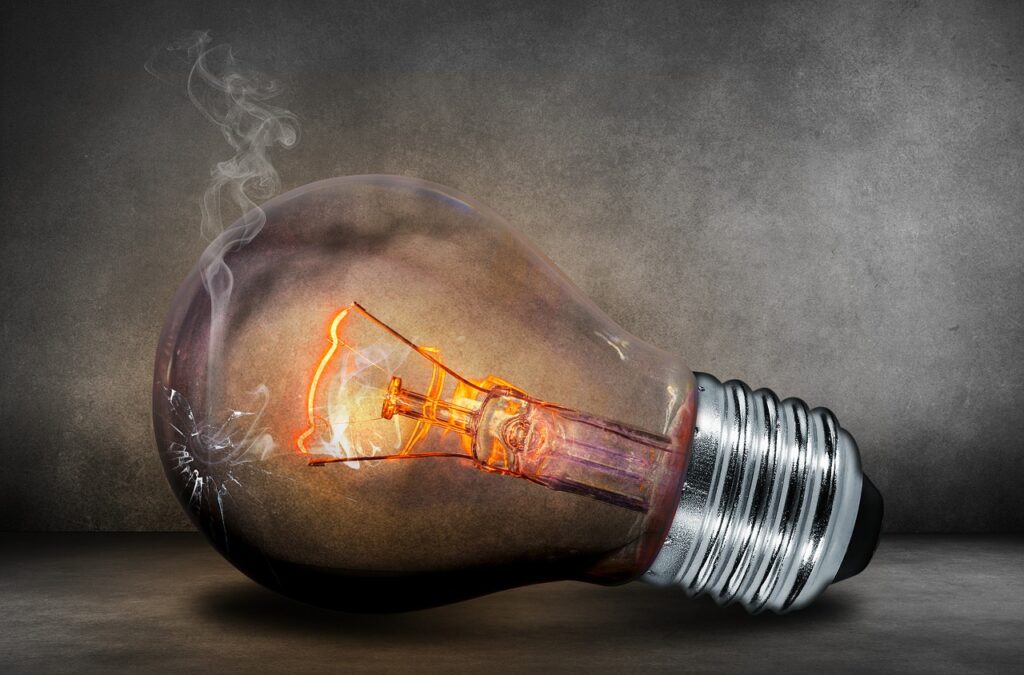
Lösungsvorschlag aus Griechenland wird kastriert
In Griechenland wurde von MeRA25 vorgeschlagen, dass die Kosten vom Staat festgelegt werden sollen nach dem Muster: Durchschnittliche Produktionskosten +5%. Damit würden die Produzenten immer noch etwas Gewinn machen, in Griechenland hätte das aber eine Strompreisreduktion von satten 50% ausgemacht. Ohne, dass dies den Staat irgendetwas gekostet hätte. Tatsächlich führte die griechische Regierung solche Preise ein, sehr zum Erstaunen von MeRA25. Bis sie in einer Fussnote des Gesetzes lesen mussten, dass die Strom-Auktionen weitergehen. Aber wofür? Die Preise sind ja staatlich vorbestimmt. Wie sich herausstellte, werden die reduzierten Kosten nicht an den Konsument:innen, sondern an die Anbieter weitergegeben, die in der Regel denselben Firmen wie auch die Produzenten gehören. Tatsächlich wird also nichts geändert. Dieses System soll nun auf Anregung der EU-Kommission auch in der restlichen EU eingeführt werden. Um die Konsument:innen zu «unterstützen», werden stattdessen die Staatsschulden erhöht, um damit einen Teil des überhöhten Preises zu bezahlen. Alles, damit die Profite der Unternehmen nicht sinken. Ob die Bevölkerung ihren Strom noch bezahlen kann, ist offensichtlich sekundär.
Drohender Bankrott trotz riesiger Profite
Viele Energiefirmen stehen in Europa trotz überhöhter Preise und riesigen Profiten aus dem Stromverkauf vor dem drohenden Bankrott, so z.B. in Deutschland. Deutschland hat seine Abhängigkeit von russischem Gas in der Vergangenheit systematisch ausgebaut, so dass zuletzt 70% des in Deutschland benutzten Gas aus Russland kam. Firmen, die vom billigen russischen Gas profitierten, sind jetzt von den Preissteigerungen massiv betroffen. Da Deutschland aktuell eine Schuldenbremse hat, die der Finanzminister nicht aufheben will, ist die direkte Unterstützung mit öffentlichen Geldern keine Option. Die Firmen sollen aber trotzdem unterstützt werden, also sollen die Konsument:innen zusätzlich zum ohnehin schon völlig überteuerten Gas eine Gebühr bezahlen, die dann zur Unterstützung der betroffenen Firmen verwendet werden soll. Energiefirmen stehen ausserdem deshalb vor einem möglichen Bankrott, weil sie sich gegen fallende Preise versichert haben. Wenn die Preise – wie aktuell – stattdessen steigen, werden die Versicherungsgebühren überproportional teurer, da mehr Gewinn versichert wird. Die Versicherungsverträge laufen über mehrere Jahre und können nicht einfach gekündigt werden. Paradoxerweise droht diesen Firmen also der Bankrott, weil sie zu hohe Profite machen. Wenn diese Firmen vom Staat gerettet werden, bedeutet das, dass der Staat neue Schulden aufnimmt, um Versicherungsgebühren für private Gewinne zu bezahlen.
Strom wieder zurück in öffentlichen Besitz
Die aktuellen Probleme lassen sich grösstenteils auf die Liberalisierung des Stromnetzes und die Schaffung des Strommarktes zurückführen. Dies muss dringend rückgängig gemacht werden. Spätestens wenn Firmen mit Steuergeldern gerettet werden, sollten sie danach konsequent in öffentlichen Besitz übergehen. Wichtig dabei ist: öffentlicher Besitz ist nicht gleich staatlicher Besitz, die Energieproduktion sollte bedarfs- statt profitorientiert und nach ökologischen Kriterien funktionieren. Dies ermöglicht auch, die dringend nötige Umstellung weg von fossilen Energieträgern zu forcieren, die im freien Markt überhaupt nicht funktioniert. Weltweit gab es 2021 ca. 700 Mia. Dollar Steuergeschenke an die Industrie für fossile Energien, fast doppelt so viel wie noch im Jahr 2020. Fossile Energieträger werden also nach wie vor aktiv gefördert. Wichtig ist aber auch, dass akut etwas gemacht wird, damit die dringendste Not der Bevölkerung gelindert wird. Das könnte beispielsweise die Umsetzung des Vorschlags von MeRA25 sein, im Bewusstsein dessen, dass dies nur ein Notpflaster für die Zeit bis zur echten Lösung ist.





Da habe ich eine bessere Idee, wie man das Stromproblehm lössen kann, mit einem Befreungsgenerator: https://drive.google.com/file/d/1zB7PywnE5GldI26QHd4Vet-nnW1Kub9V/view?usp=share_link