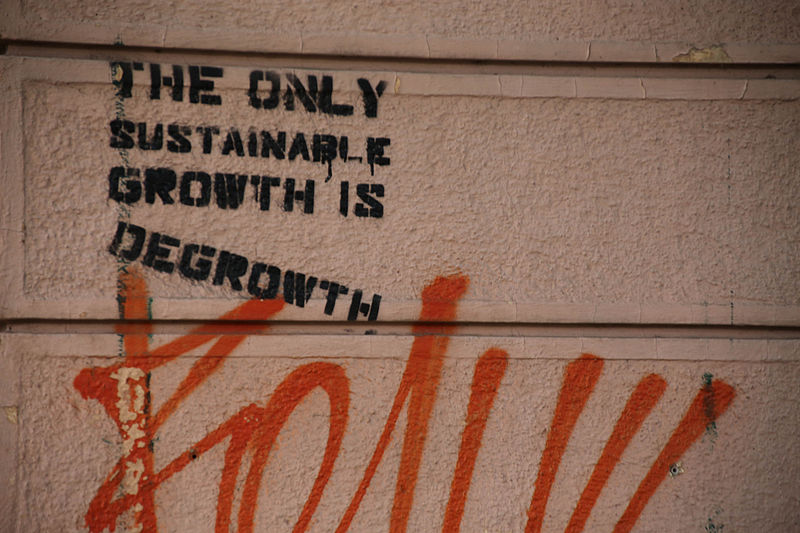Im Rahmen der Klimastreik-Bewegung formiert sich seit einigen Monaten ein weltweiter Widerstand gegen die Klimapolitik der Reichen und Mächtigen. Auch in der Schweiz kam es in diesem Kontext zu Mobilisierungen, die in ihrer Grösse und Breite für die hiesigen Verhältnisse bemerkenswert sind. Die Bewegung ist im Begriff, die längst überfällige Debatte über die Klimakrise, deren politische und ökonomische Ursachen und mögliche Lösungen anzufachen. Ein wichtiger Aspekt dieser Debatte dreht sich um die Frage des Wirtschaftswachstums. In verschiedenen Kontexten wird diese Problematik schon seit längerem unter Begriffen wie «Décroissance», «Degrowth» oder «Postwachstum» verhandelt.
von Michael Tulpe (BFS Zürich) und Xavier Balaguer
Seit 2008 entwickelt sich in Europa so etwas wie eine Degrowth-Bewegung, die eine fächerübergreifende akademische Strömung der Wachstumskritik mit aktivistischen Elementen kombiniert.[1] Das Kernargument der Degrowth-Bewegung ist, dass das bestehende, auf ewiges und ungebrochenes Wachstum ausgerichtete Wirtschaftsmodell die Ursache aktueller ökologischer Krisen und sozialer Missstände darstellt und daher durch ein auf das Gegenteil – nämlich ein auf die Schrumpfung der Wirtschaft – ausgerichtetes Modell ersetzt werden muss. Dies wird nicht im Sinne einer «Umkehrung» des historischen Wachstums verstanden, sondern als Leitmotiv in der Entwicklung sozialer und ökonomischer Alternativen zur Wachstumsgesellschaft.
Wachstum und Kapitalismus
Fakt ist, dass sich der Kapitalismus nur unter der Bedingung von mehr oder weniger konstantem Wachstum stabilisieren kann. Die kapitalistische Marktwirtschaft basiert auf der Konkurrenz derer, die die Produktionsmittel besitzen. Diese Konkurrenz resultiert in der Notwendigkeit, immer mehr Profit zu generieren – also Kapital anzuhäufen – damit ein Teil davon wieder in die Optimierung des Produktionsprozesses und der Produktivität investiert werden und so dem Unternehmen gegenüber der Konkurrenz einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. Dieser Druck, immer mehr Kapital zu akkumulieren, führt, neben der Ausbeutung der Arbeiter:innen, auch unweigerlich zum Zwang, kontinuierlich mehr Produkte und Dienstleistungen zu produzieren und zu verkaufen. Der Kapitalismus muss also immer mehr produzieren, um zu überleben. Dabei spielen die Bedürfnisse der Menschen keine Rolle: Wenn die Bedürfnisse befriedigt sind, müssen künstlich neue geschaffen werden, um die Maschinerie am Laufen zu halten. Die Konsequenz dieser Dynamik ist, dass die zur Waren und Dienstleistungsproduktion benötigten Rohstoffe und Energiequellen immer intensiver ausgebeutet werden müssen, was – wie inzwischen offensichtlich ist – zu einem Ausmass von Naturzerstörung führt, das nicht nur die Existenzbedingungen des Kapitalismus, sondern auch jene der Menschen und des Planeten selbst erodiert.
Ist Wachstumskritik auch Kapitalismuskritik?
Die Kritik am Wachstum ist also – so würde mensch meinen – eine Position, welche die kapitalistische Produktions weise an sich in Frage stellt. Trotzdem hagelte es von marxistischer Seite Kritik, als der französische Wirtschaftsanthropologe Serge Latouche in den Nullerjahren den Begriff Décroissance popularisierte und sich ein politischer Diskurs und eine aktivistische Praxis darum bildete. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die intellektuelle Basis von Latouches Degrowth-Begriff einige zentrale blinde Flecken aufweist.[2] Erstens wird in dieser Strömung der Degrowth-Bewegung versucht, die sozialistische Kritik am Kapitalismus von der Kritik am Wirtschaftswachstum zu trennen. Das Wachstum wird hier nicht etwa als das zwangsläufige Resultat kapitalistischer Akkumulationsprozesse dargestellt, sondern als ein Problem, das grundsätzlich im Kapitalismus gelöst werden könnte. Latouche fordert eine Schrumpfung der Wirtschaft im Rahmen eines stark regulierten Öko-Kapitalismus. Die Behauptung, dass innerhalb des Kapitalismus ein negatives Wirtschaftswachs tum, also Degrowth, möglich sei, ist aus sozialer Perspektive aber mehr als bedenklich. Die Krise von 2008 hat – ironischer weise parallel zum Aufkommen der Degrowth-Bewegung – gezeigt, was es in der kapitalistischen Realität bedeutet, wenn das Wirtschaftswachstum sich verlangsamt oder die Wirtschaft gar schrumpft: Massenarbeitslosigkeit, Austerität, Banken-Bailouts, massive Privatisierungswellen und so weiter.
Wer ist Schuld an der ökologische Krise?
Ein zweiter blinder Fleck bei Latouche ist, dass er die momentane ökologische Krise als ein Problem betrachtet, das die gesamte Menschheit, sozusagen als «Spezies», betrifft und für das alle gleichermassen verantwortlich sind. Dies vernebelt die Tatsache sozialer Ungleichheit, da ärmere Leute erwiesenermassen viel stärker von ökologischen Katastrophen betroffen sind. Gleichzeitig verkennt es den Fakt, dass Menschen mit wenig Einkommen einen kleineren ökologischen Fussabdruck haben als solche mit hohen Einkommen – vom Fussabdruck der grossen Konzerne ganz zu schweigen.[3] Die im Kontext der Degrowth-Bewegung oft aufgestellte Aufforderung, alle müssten gleichermassen «kleiner leben», also den individuellen Konsum einschränken und «den Gürtel enger schnallen», erinnert stark an die Rhetorik der Austerität und ist als Kommunikationsstrategie völlig ungeeignet. Die ökologischen Kosten, welche die kapitalistische Produktionsweise verursacht, werden so auf jene abgewälzt, die sie am wenigsten zu verantworten haben: die Lohnabhängigen.
Dieses Konzept von Degrowth zeichnet sich auch durch einen sehr problematischen Umgang mit der Ungleichheit zwischen dem globalen Süden und den Industrienationen aus. So findet Latouche, das Degrowth-Prinzip müsse auf die Länder des globalen Südens gleichermassen angewendet werden wie auf die Industriestaaten, die an der ökologischen Krise die Hauptverantwortung tragen. Der globale Süden würde sonst den Fehler des Westens wiederholen und in die Sackgasse des «Wachstumsfetisch» laufen. Die Forderungen an die Menschen in der dritten Welt, auf ökonomisches Wachstum zu verzichten und ihren Konsum einzuschränken, ist erstens zynisch und verkennt zweitens die imperialistischen Abhängigkeitsverhältnisse, deren Beseitigung die Voraussetzung für eine selbstbestimmte Entwicklung des globalen Südens darstellt.
Degrowth – Eine heterogene Bewegung
Wenn wir aus marxistischer Perspektive unsere Positionierung gegenüber der Degrowth-Bewegung diskutieren, ist es allerdings wichtig, zu differenzieren. Es gibt keine einheitliche Degrowth-Theorie und die Bewegung ist sehr heterogen. In zwischen haben sich grosse Teile davon von Latouches Vorstellungen entfernt. Ökomarxistische Theoretiker:innen haben in die Debatte interveniert und diese massgeblich geprägt, indem sie die Zusammenhänge zwischen Kapitalakkumulation und Wachstum aufzeigten. Inzwischen sind jene, die an die Möglichkeit von Degrowth im kapitalistischen System glauben, innerhalb der Bewegung in einer Minderheit gegenüber jenen, die Degrowth als ein transformatorisches Programm verstehen, welches die Überwindung kapitalistischer Verhältnisse gleichzeitig voraussetzt und vorantreibt, also den Systemwandel fordert. So war an der letzten internationalen Konferenz der Degrowth-Bewegung in Malmö die Kapitalismuskritik in fast jedem Panel greifbar. Die Bewegung ist zwar nach wie vor stark akademisch geprägt, hat ihre soziale Basis weiterhin bei den besser gestellten Lohnabhängigen und bleibt vorerst weitgehend weiss und europäisch. Fragen von sozialer und globaler Ungleichheit finden aber mit dem Erstarken radikal linker Perspektiven in der Bewegung viel mehr Gehör, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. So wird inzwischen aktiv versucht, Aktivist:innen und Intellektuelle aus dem globalen Süden miteinzubeziehen. Im letzten Jahr fand erstmals eine Konferenz zu Degrowth und der Nord-Süd-Problematik in Mexiko statt. Es gibt also keinen Grund, die Degrowth-Debatte aufgrund des Standes, auf dem sie vor 10 Jahren war, abzuschreiben. Ganz im Gegenteil ist diese Bewegung ein Forum, das momentan sehr empfänglich für Interventionen aus antikapitalistischer und marxistischer Perspektive ist.
Von «Techno-Fixes» und dem Markt als zentralem Organisationsprinzip
Dennoch ist Degrowth noch weit davon entfernt, klare politische Strategien für den Übergang in eine Postwachstumsgesellschaft entwickelt zu haben. Dazu gibt es innerhalb der Debatte viele verschiedene Ansätze, von Experimenten solidarischer Landwirtschaft und alternativer Ökonomien (Commoning, Sharing Economy etc.) bis zu politischen Forderungen nach einer radikalen Verkürzung der Arbeitszeit und einem Grundeinkommen. Aus marxistischer Perspektive mögen diese Ansätze zum Teil mehr, zum Teil weniger Sinn machen. Was die momentane Degrowth-Debatte aber grundsätzlich interessant macht, ist, dass sie den Markt als das zentrale Organisationsprinzip der Gesellschaft radikal in Frage stellt und eine Re-Politisierung der Wirtschaft sowie eine demokratische Debatte über die Formen von Produktion und Konsum fordert.
Es ist durchaus möglich, dass die Degrowth-Debatte fruchtbare Impulse in die Diskussionen um den Begriff des Ökosozialismus bringen könnte. Innerhalb der marxistischen Linken findet sich eine starke ökomodernistische Tendenz, die der Überzeugung ist, dass es für die aktuelle Klimakrise rein technologische Lösungen gibt bzw. geben wird, die eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und erhöhtem Ressourcenverschleiss möglich machen. In einer Spezialausgabe zum Klimawandel des US-amerikanischen Magazins Jacobin, das sich als die führende Stimme der USLinken betrachtet, ist von natürlichen Grenzen des Wachstums keine Rede.[4] Unter dem Motto «Think Big instead of live small» wird argumentiert, das eine zentralistisch geplante, demokratische, auf dem Aufbau grossräumiger Infrastruktur basierende, sozialistische Wirtschaft moderne Technologie rationaler einsetzen könnte als der Kapitalismus, und so theoretisch unendliches Wachstum ermöglichen würde. Es findet sich in der Ausgabe praktisch nichts über die Notwendigkeit, die Exzesse der Extraktionsindustrie wie Fracking oder den Abbau von Braunkohle und Teersand zu stoppen. Die Lösungsvorschläge für die ökologische Krise drehen sich um sogenannte «Techno-Fixes» – rein technologische Lösungen – in Gebieten wie Geo-Engineering, Gentechnik, Atomstrom, oder CSS (Kohlenstoff-Bindung und Speicherung), die grünes Wachstum in einer postkapitalistischen Ökonomie ermöglichen sollen. Dass Technologien wie CSS tatsächlich das halten können, was sie zu versprechen scheinen, wird von Wissenschaftler:innen indes als unrealistisch eingeschätzt.[5] Dieses technooptimistische Festhalten am Wachstumsprinzip unterminiert nicht etwa die ideologischen und ökonomischen Grundlagen einer auf Beherrschung und Ausbeutung basierenden Mensch-Natur-Beziehung, die der Kapitalismus erzeugt hat, sondern ist deren direkte Fortsetzung. Es scheint, als seien Teile der sozialistischen Bewegung hinter den Stand des späten 19. Jahrhunderts zurückgefallen, als Engels bemerkte: «Wir beherrschen die Natur nicht, sondern wir gehören ihr an, stehen in ihr. Unser Vorzug als Menschen ist nur, dass wir ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden können. Schmeicheln wir uns indes nicht so sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns…»[6]
Braucht es überhaupt Wachstum für ein gutes Leben?
Dabei wäre es aus ökosozialistischer Perspektive überhaupt nicht nötig, an der Idee von konstantem, unbegrenztem Wachstum festzuhalten. Wachstum im kapitalistischen Sinne, also die quantitative Vermehrung der Produktion von Tauschwerten, war schliesslich nie das Ziel des sozialistischen Projekts. Die Ziele des Sozialismus sind konkret: gleicher Zugang für alle zu würdigen Lebensbedingungen, einer intakten Natur, Bildung, Gesundheit, gute Ernährung, politische und ökonomische Mitbestimmungsrechte und so weiter. All das braucht Ressourcen. Was es aber nicht braucht, ist eine jährliche Wachstumsrate der Wirtschaft von 3%. Der Kapitalismus produziert immer mehr Tauschwerte, während der Anteil von wirklichen, gesellschaftlich notwendigen Gebrauchswerten, die im Produktionsvolumen enthalten sind, immer kleiner wird. In der Tat könnten wir heute das Gesamtvolumen der Produktion verkleinern und gleichzeitig mehr Dinge produzieren, die wir tatsächlich brauchen. Diese echten Bedürfnisse sind dabei keine objektive Grösse, sondern das Resultat eines Prozesses demokratischer Aushandlung. Der Idee nachzuhängen, dass eine Steigerung der Lebensqualität an ein Wachsen der Wirtschaft und den Konsum möglichst vieler Waren gekoppelt ist, würde heissen, den blinden Produktivismus und das beschränkte Menschenbild der bürgerlichen Ideologie zu übernehmen. In dieser Hinsicht können wir von der Degrowth-Debatte lernen, da dort ernsthafte Anstrengungen unternommen werden, sich weg von einem quantitativen und hin zu einem qualitativen Verständnis von menschlichen Bedürfnissen, Lebensqualität und Entwicklung zu bewegen und eine politische Praxis zu entwickeln, die sich daran orientiert.
Es ist klar, dass die Konsumökonomie, wie sie heute in den westlichen Industriestaaten existiert, für eine Welt mit über 8 Milliarden Menschen ökologisch nicht tragbar ist. Die ökonomisch bessergestellten Menschen in diesen Ländern werden sich daran gewöhnen müssen, mit «weniger» zu leben, zumindest was den Konsum von Waren angeht. Gleichzeitig könnte ein Fokus auf die Befriedigung von echten menschlichen Bedürfnissen im Rahmen ökologischer Nachhaltigkeit ein konstitutives Prinzip einer neuen, kommunalistischen, auf Solidarität gegründeten Ordnung sein, die qualitative Verbesserungen der Lebensumstände und eine Neudefinition menschlicher Bedürfnisse jenseits von Warenfetisch und Profitstreben möglich machen. Allerdings muss weiterhin jede Konzeption von Degrowth, die ein Schrumpfen der Wirtschaft auf Kosten derer befürwortet, die jetzt schon unter prekären Bedingungen zu leben gezwungen sind, scharf kritisiert werden. Wie der marxistische Soziologe John Belamy Foster festhält, «reicht es nicht aus, seine gesamte Analyse auf der Kritik einer abstrakten Wachstumsgesellschaft zu gründen». Degrowth ist ein wertvolles Konzept im ökologischen Sinn, politisch bedeutungsvoll wird es aber erst dort, wo die Wachstumskritik mit der Kritik an Kapital, Patriarchat, Rassismus und Imperialismus einhergeht.[7] Glücklicherweise scheinen sich grosse Teile der Degrowth-Bewegung seit einigen Jahren in diese Richtung zu bewegen. Es ist gut möglich, dass sich hier ein politischer Raum bildet, in dem neue Allianzen für eine emanzipatorische Bewegung geschmiedet werden können.
[1] Für eine Ausführung dieser Kritik siehe: John Belamy Foster: «Capitalism and Degrowth: An Impossibility Theorem», Monthly Review, Januar 2011.
[2] Für eine Ausführung dieser kritik siehe: John Belamy Foster: «Capitalism and Degrowth: An Impossibility Theorem», Monthly Review, Januar 2011.
[3] Zur Verteilung von Carbon Footrpint by income and region: siehe Grafik. Quelle: https://ourworldindata.org/co2-by-income-region
[4] Für Kritik an Jacobin’s Vorstellungen zu Ökosozialismus siehe: Ian Angus: «Memo to Jacobin: Ecomodernism is not Ecosocialism», Canadian Dimension, 17. Januar 2018.
[5] Siehe: Andy Skuce. «We’d have to finish one new facility every working day for the next 70 years’—Why carbon capture is no panacea», Bulletin of the Atomic Scientists. 04. 10. 2016: https://the- bulletin.org/2016/10/wed-have-to-finish-one-new-facility-every-working-day-for-the-next-70-years-why-carbon-capture-is- no-panacea/
[6] MEW 20, 1978, S. 452-453
[7] John Belamy Foster: «Capitalism and Degrowth: An Impossibility Theorem», Monthly Review, Januar 2011.