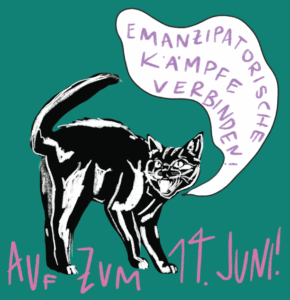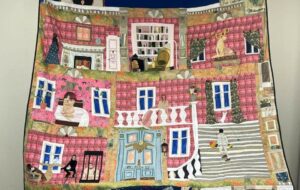Über die Entstehung der Hausarbeit und die Ursprünge der kapitalistischen Geschlechterordnung.
von Silvia Federici*; aus: analyse & kritik
Worauf gründet die soziale und wirtschaftliche Ausbeutung der Frauen im Kapitalismus? Diese Frage beschäftigte Mitte der 1970er Jahre die US-Frauenbewegung. Die damals vorherrschenden theoretischen und politischen Sichtweisen auf die Realität der Geschlechterdiskriminierung gingen auf die beiden Hauptströmungen der Frauenbewegung zurück: die radikalen Feministinnen und die sozialistischen Feministinnen. Doch keiner der beiden Ansätze bot eine befriedigende Erklärung für die Ursprünge der Frauen-»Unterdrückung«.
Den Ansatz der radikalen Feministinnen lehnte ich aufgrund seiner Tendenz ab, Geschlechterdiskriminierung und patriarchale Herrschaft aus überhistorischen kulturellen Strukturen zu erklären, die ihre Wirkung unabhängig von den Produktions- und Klassenverhältnissen entfalten würden. Die sozialistischen Feministinnen erkannten dagegen an, dass die Geschichte der Frauen nicht von der Geschichte spezifischer Ausbeutungssysteme zu trennen ist. In ihren Analysen wurden Frauen vor allem als Arbeiterinnen in einer kapitalistischen Gesellschaft betrachtet. Dieser Ansatz sparte jedoch die Reproduktionssphäre als Quelle von Wertschöpfung und Ausbeutung aus. Er führte das Machtgefälle zwischen Frauen und Männern somit auf den Ausschluss der Frauen aus der kapitalistischen Entwicklung zurück. Dieser Standpunkt warf uns, wenn wir den Fortbestand des Sexismus im Kosmos kapitalistischer Verhältnisse erklären wollten, erneut auf kulturelle Schemata zurück.
In diesem Kontext entstand die Idee, die Geschichte der Frauen im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus zu rekonstruieren. Die These, von der sich das Forschungsprojekt leiten ließ, das ich mit der italienischen Feministin Leopoldina Fortunati begann, wurde erstmals von Mariarosa Dalla Costa, Selma James und anderen Frauen aus der Lohn-für-Hausarbeit-Bewegung formuliert. Ihre Texte waren in den 1970er Jahren sehr umstritten, prägten den Diskurs über Frauen, Reproduktion und Kapitalismus aber stark. (1)
Produzentinnen der Arbeitskraft
Gegen die marxistische Orthodoxie, die die »Unterdrückung« der Frauen und ihre Unterordnung unter die Männer als Überbleibsel feudaler Verhältnisse erklärte, vertraten Dalla Costa und James die Position, die Ausbeutung der Frauen habe im Prozess kapitalistischer Akkumulation eine zentrale Rolle gespielt. Denn Frauen sind die Produzentinnen und Reproduzentinnen der grundlegendsten kapitalistischen Ware: der Arbeitskraft. Die unbezahlte Hausarbeit der Frauen war für Dalla Costa der Sockel, auf dem die Ausbeutung der Lohnarbeiter errichtet wurde – und das Geheimnis ihrer Produktivität.
Gegen die Behauptung, die Hausarbeit der Frauen sei für die kapitalistische Akkumulation nicht von Bedeutung, spricht bereits das strenge Regelwerk, das das Leben der Frauen beherrscht hat. Das Machtgefälle, das in der kapitalistischen Gesellschaft zwischen Frauen und Männern besteht, ist auch kein Überbleibsel zeitloser kultureller Schemata. Vielmehr ist es die Folge eines gesellschaftlichen Produktionssystems, das die Produktion und Reproduktion des Arbeiters nicht als sozioökonomische Tätigkeit und Quelle der Kapitalakkumulation anerkennt. Es mystifiziert sie vielmehr als Naturressource oder persönliche Dienstleistung und profitiert vom nicht entlohnten Charakter der damit einhergehenden Arbeit.
Indem sie die Ausbeutung der Frauen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft auf die geschlechtliche Arbeitsteilung und die unbezahlte Arbeit der Frauen zurückführten, machten Dalla Costa und James den Weg frei für eine Neuinterpretation der Geschichte des Kapitalismus und des Klassenkampfes aus feministischer Sicht.
Im Sinne dieser These begannen Leopoldina Fortunati und ich mit dem Studium dessen, was sich nur euphemistisch als »Übergang zum Kapitalismus« bezeichnen lässt. Wir begaben uns auf die Suche nach einer Geschichte, die man uns nicht auf der Schule gelehrt hatte, die sich aber als maßgeblich für unsere Bildung erweisen sollte.
Diese Geschichte bot nicht nur ein theoretisches Verständnis der Genese der Hausarbeit und ihrer wichtigsten strukturellen Komponenten: der Trennung der Produktion von der Reproduktion; des spezifisch kapitalistischen Gebrauchs des Lohnes als Mittel, um die Arbeit von Nicht-Entlohnten zu kommandieren; der Abwertung der gesellschaftlichen Stellung der Frauen während des Aufstiegs des Kapitalismus. Sie bot auch einen neuen Blick auf die Ursprünge moderner Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit – einen Blick, der die postmoderne Annahme in Frage stellte, die »westliche Kultur« sei aufgrund ihrer Denk- und Ordnungstraditionen quasi dazu verdammt, Gender in Begriffspaaren (binären Oppositionen) aufzufassen. Wir entdeckten, dass Geschlechterhierarchien stets im Dienst eines Herrschaftsprojekts stehen, das sich nur insofern zu verstetigen vermag, als es die zu Beherrschenden stets aufs Neue spaltet.
Ursprüngliche Akkumulation und Reproduktionssphäre
Das aus diesem Forschungsprojekt hervorgegangene Buch, »Il Grande Calibano« (2), war ein Versuch, Marx‘ Analyse der ursprünglichen Akkumulation (3) aus feministischer Perspektive neu zu reflektieren. Dabei erwiesen sich jedoch die tradierten Marxschen Kategorien als unzulänglich. Unhaltbar war etwa die Marxsche Gleichsetzung des Kapitalismus mit dem Aufstieg der Lohnarbeit und des »freien« Arbeiters. Diese Gleichsetzung trägt weiterhin dazu bei, die Reproduktionssphäre zu verbergen und zu naturalisieren.
»Il Grande Calibano« kritisierte auch Michel Foucaults Theorie des Körpers: Foucaults Analyse der Machttechniken und Disziplinierungen, denen der Körper unterworfen worden sei, ignoriert den Reproduktionsprozess, verschmilzt Frauen- und Männergeschichte zu einem unterschiedslosen Ganzen. Sie interessiert sich so wenig für die »Disziplinierung« der Frauen, dass sie einen der monströsesten Angriffe auf den Körper, zu dem es in der Neuzeit gekommen ist, nie erwähnt: die Hexenverfolgungen.
Unsere Hauptthese lautete, dass wir die Veränderungen analysieren müssen, die der Kapitalismus im Prozess der gesellschaftlichen Reproduktion und insbesondere in der Reproduktion der Arbeitskraft herbeigeführt hat, wenn wir die Geschichte der Frauen im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus verstehen wollen. Das Buch untersuchte also, wie Hausarbeit, Familienleben, Kindererziehung, Sexualität, Geschlechterverhältnisse und das Verhältnis von Produktion und Reproduktion im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts neu geordnet wurden.
Kurz nach der Veröffentlichung von »Il Grande Calibano« verließ ich die USA und nahm eine Lehrstelle in Nigeria an, wo ich fast drei Jahre lebte. Vor meiner Abreise hatte ich meine Unterlagen im Keller vergraben, denn ich rechnete nicht damit, sie in absehbarer Zeit wieder zu benötigen. Doch die Umstände meines Aufenthalts in Nigeria erlaubten es mir nicht, diese Arbeit zu vergessen. Die Jahre zwischen 1984 und 1986 waren für Nigeria ebenso wie für die meisten afrikanischen Länder ein Wendepunkt. In jenen Jahren nahm die nigerianische Regierung infolge der Schuldenkrise Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank auf. Diese Verhandlungen mündeten schließlich in einem Strukturanpassungsprogramm; die so bezeichneten Maßnahmenpakete sind das Universalrezept der Weltbank für wirtschaftliche Erholung in Ländern der ganzen Welt.
Erklärtes Ziel des Programms war es, Nigeria auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu machen. Es wurde jedoch bald deutlich, dass dies eine Neuauflage der ursprünglichen Akkumulation beinhaltete. Gleichzeitig wurde die gesellschaftliche Reproduktion derart rationalisiert, dass die letzten Reste gemeinschaftlichen Eigentums und gemeinschaftlicher Verhältnisse zerstört und damit intensivere Formen der Arbeitsausbeutung durchgesetzt wurden.
So spielten sich vor meinen Augen Vorgänge ab, die denen, die ich im Zuge der Vorarbeiten für »Il Grande Calibano« studiert hatte, stark ähnelten. Dazu zählten Angriffe auf gemeinschaftlich verwaltete Ländereien und eine entscheidende (von der Weltbank angeordnete) Intervention des Staates in die Reproduktion der Arbeitskraft, bei der es um die Regulierung der Geburtenrate ging. Im Fall Nigerias ging es um die Verkleinerung einer Bevölkerung, die als zu anspruchsvoll und undiszipliniert galt, um sie wie geplant in die Weltökonomie einzugliedern.
Darüber hinaus wurde eine frauenfeindliche Kampagne losgetreten, die die vermeintliche Eitelkeit und die überzogenen Forderungen der Frauen geißelte. Darum entspann sich eine hitzige Debatte, die in vielerlei Hinsicht an die Querelle des Femmes des 17. Jahrhunderts (4) erinnerte. Dabei wurden sämtliche Aspekte der Reproduktion der Arbeitskraft berührt: Familie (polygame versus monogame Familie, Kernfamilie versus Großfamilie), Kindererziehung, Frauenarbeit, männliche bzw. weibliche Identität und Geschlechterverhältnisse.
Kämpfe gegen die kapitalistische Lebensweise
In Nigeria wurde mir bewusst, dass der Kampf gegen Strukturanpassung Teil eines längeren Kampfes gegen Landprivatisierung und die »Einhegung« nicht nur von gemeinschaftlich verwaltetem Land, sondern auch von gesellschaftlichen Beziehungen ist. Dieser Kampf reicht bis zu den Ursprüngen des Kapitalismus im Europa und Amerika des 16. Jahrhunderts zurück. Mir wurde auch bewusst, wie beschränkt der Triumph der kapitalistischen Arbeitsdisziplin auf diesem Planeten ausgefallen ist, da viele Menschen ihr Leben immer noch auf eine Weise wahrnehmen, die sich radikal gegen die Erfordernisse der kapitalistischen Produktion stellt.
Für die EntwicklungsplanerInnen, die multinationalen Agenturen und die ausländischen Investoren war und bleibt dies das Problem mit Orten wie Nigeria. Für mich stellte diese Beobachtung jedoch eine Quelle großer Kraft dar, denn sie bewies, dass sich auf der ganzen Welt immer noch beeindruckende Kräfte der kapitalistischen Lebensweise widersetzen.
Ende 1986 hatte die Schuldenkrise die akademischen Institutionen erreicht. Ich war nicht mehr in der Lage, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und verließ Nigeria. Doch der Gedanke an die Angriffe auf die Menschen Nigerias hat mich nie verlassen. Daher hegte ich, als ich wieder in die USA zurückkehrte, den Wunsch, den »Übergang zum Kapitalismus« aufs Neue zu studieren. Mein Blick auf die Ereignisse in Nigeria war von meinem Wissen um das Europa des 16. Jahrhunderts geprägt. In den USA war es das nigerianische Proletariat, das mich zurückführte zu den Kämpfen um Commons und die kapitalistische Disziplinierung der Frauen, innerhalb wie außerhalb Europas.
Deswegen rekonstruierte ich in »Caliban und die Hexe« die antifeudalen Kämpfe des Mittelalters und die Kämpfe, durch die sich das europäische Proletariat dem Aufstieg des Kapitalismus widersetzt hat. Der Erhalt dieses historischen Gedächtnisses ist von zentraler Bedeutung, wenn wir eine Alternative zum Kapitalismus entwickeln wollen. Denn die Möglichkeit einer solchen Alternative hängt auch von unserer Fähigkeit ab, die Stimmen derer zu vernehmen, die vor uns ähnliche Wege beschritten haben.
*Silvia Federici ist feministische Aktivistin und Autorin. Die emeritierte Professorin für politische Philosophie und Womens Studies lebt in New York. Der Beitrag basiert auf dem Vorwort zu dem Buch »Caliban und die Hexe. Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation« von Silvia Federici, das 2012 erstmals in deutscher Übersetzung im Wiener Mandelbaum Verlag erschien (Übersetzung: Max Henninger).
—
Anmerkungen:
1) Die einflussreichsten dieser Texte waren »Die Frauen und der Umsturz der Gesellschaft« von Mariarosa Dalla Costa (1971) und »Sex, Race and Class« von Selma James (1975).
2) »Il Grande Calibano. Storia del corpo sociale ribella nella prima fase del capitale« (»Der Große Caliban. Geschichte des rebellischen Körpers in der ersten Phase des Kapitalismus«) erschien 1984 in Italien. Eine deutsche Übersetzung gibt es nicht.
3) Marx fragt sich am Ende des ersten Bandes des »Kapital«, wie es geschehen konnte, dass Kapital und Lohnarbeit zwar formal gleich sind, die ArbeiterInnen aber dennoch vom Kapital ausgebeutet werden. Für Marx ist die »sogenannte ursprüngliche Akkumulation« ein gewaltsamer, blutiger Prozess, in dessen Verlauf etwa in England der Staat den Großgrundbesitzern half, die Bäuerinnen und Bauern von dem Land zu vertreiben, das sie bewirtschaftet hatten. Durch die Trennung der unmittelbaren ProduzentInnen von den Produktionsmitteln entstand der »doppelt freie Lohnarbeiter« (frei vom Kommando persönlicher Herrschaft wie zu Zeiten des Feudalismus, aber auch frei von Eigentum an Produktionsmitteln), der in die Fabriken gezwungen wurde, weil er keine Möglichkeiten mehr hatte, von der Produktion für den eigenen Bedarf zu leben.
4) Unter diesem Begriff werden die Debatten über die gesellschaftliche Stellung der Frau im Europa der frühen Neuzeit zusammengefasst.