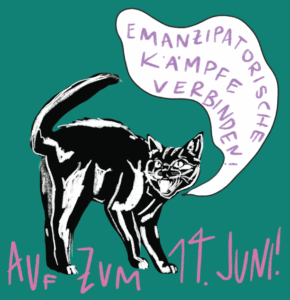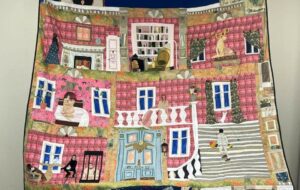Die chilenisch-katalanische Feministin und Ökonomin Cristina Carrasco Bengoa ist der Ansicht, dass die Ökonomie diejenige Disziplin ist, die sich am hartnäckigsten gegen Veränderungen wehrt. Ihre Arbeit an der Fakultät für Wirtschaftstheorie an der Universität in Barcelona hat wichtige Beiträge zur feministischen Ökonomie hervorgebracht. Ihre Fakultät ist Teil eines Masterstudiengangs zur Geschlechterforschung und hat vor kurzem ein Doktorat erhalten. Derzeit werden verschiedene Studiengänge überarbeitet, um künftig auch Alternativen zum Kapitalismus in Lehre und Forschung miteinzubeziehen.
aus alencontre.org
Strebt die feministische Ökonomie die Gleichheit zwischen Männern und Frauen an?
Zur Geschlechter- oder Genderökonomie gehören natürlich auch Untersuchungen über die Gleichheit zwischen Männern und Frauen, aber sie geht auch klar über dieses Ziel hinaus!
Weil Gleichheit alleine für sie nicht wünschenswert ist?
Doch natürlich, aber was bedeutet diese Gleichheit? Gleichheit impliziert nicht zwangsläufig einen Systemwechsel. Darüber hinaus ist mit Gleichheit oft implizit gemeint, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt gleichberechtigt mit den Männern agieren sollen. Die üblichen Indikatoren der Wirtschaftswissenschaften sind etwa die Erwerbsquote von Frauen, die Lohnunterschiede, die Anzahl von Frauen, die Mandatsträger sind oder etwa ihre Präsenz in technischen Berufen usw. Ich habe noch nie Indikatoren gesehen, die etwa nach der Rate von Männern fragen, die die Blusen ihrer Frauen bügeln oder die sich um ihre an Alzheimer erkrankten Grosseltern kümmern. Derartige Aspekte werden von der Gleichheitsforschung oft vernachlässigt.
Die gängigen Indikatoren implizieren also, dass sich das Verhalten der Frauen demjenigen der Männer anpassen soll und nicht umgekehrt?
Ja. Stellen wir uns vor, wir erreichen diese „Gleichheit“ im Rahmen eines Systems, das weiterhin ausbeutet und Schaden anrichtet. In so einem System wird Gleichheit nie alle Bereiche erfassen und auch nicht immer fortschrittlich sein. Früher waren junge Mädchen stark an der Hausarbeit beteiligt, während die Jungen nichts machen mussten. Heute machen weder die Mädchen noch die Jungen etwas.
Jungen und Mädchen sind „gleich“ geworden, insofern heute beide gleichermassen prekär auf den Arbeitsmarkt gelangen. Eine derartige Gleichheit will ich nicht. Ich finde, wir müssen die Perspektive wechseln und eine andere, nachhaltigere Welt schaffen. Eine solche Perspektive ist im Rahmen der bestehenden Verhältnisse nicht realistisch.
Und was ist mit der Intersektionalität?
Ungleichheit existiert in verschiedenen Bereichen. Selbst wenn wir uns vorstellen, dass Männer und Frauen dieselben Aktivitäten ausüben – was übrigens im Kapitalismus schwierig vorzustellen ist – würde die Ungleichheit zwischen den sozialen Klassen weiterexistieren. Es gehört zum Wesen selbst des Kapitalismus, dass die einen die anderen ausbeuten. In der aktuellen Welt ist es unmöglich, reich zu werden, ohne von der Arbeit anderer zu profitieren. Wir können zwar versuchen, selbst hart zu arbeiten, aber abgesehen von Lottogewinnen ist es unmöglich, reich zu werden, ohne andere direkt oder indirekt auszubeuten.
Die feministische Ökonomie behauptet, dass die Wirtschaftsstatistiken die Realität nicht widerspiegeln…
Die (bürgerliche) Ökonomie nimmt nur die Zeit zur Kenntnis, die im Rahmen des Arbeitsmarktes und der Erwerbsarbeit aufgewendet wird. Diese wird seit der Industrialisierung in Stunden angegeben. Was ausserhalb dieses Rahmens geschieht, hat für die bürgerliche Ökonomie keine Bedeutung.
So wie im Pflege- und Carebereich, wo gegenseitige emotionelle Beziehungen bestehen…
Ja. Ganz grundsätzlich ist es in diesem Bereich schwierig zu sagen, dass auf der einen Seite die Pflegenden und auf der anderen Seite diejenigen sind, die gepflegt werden. Es gibt Momente im Leben, vor allem am Anfang und am Schluss des Lebens, in denen wir alle von Pflege abhängen! In einem weiteren Sinne bleibt diese Pflegebedürftigkeit ein Leben lang bestehen; manchmal eher in körperlicher, manchmal eher in emotionaler Hinsicht. All diese Aspekte, die für unser Leben zentral sind, werden oft nicht zur Kenntnis genommen.
Ist es möglich, diese Art von Arbeit zu messen?
Ein Teil der Pflege- und Carearbeit ist schon messbar, aber im Wesentlichen geht es in der Pflegearbeit doch auch um subjektive und emotionale Beziehungsaspekte zwischen Menschen. Diese lassen sich nicht in Zahlen ausdrücken.
Ist das der Grund, weshalb die feministische Ökonomie das Blickfeld auf unsere Gesellschaft und Ökonomie erweitern möchte?
Es gibt heterodoxe, also jenseits des Mainstreams liegende ökonomische Ansätze, seien sie nun marxistisch oder keynesianisch, die sich mit anderen Bereichen und Themen wie etwa Armut oder Rentenungleichheit auseinandersetzen, aber dennoch in der Logik der Mainstreamökonomie verhaftet bleiben. Die einzigen Wirtschaftstheorien, die den Rahmen des Marktes verlassen haben, sind ökologische Wirtschaftstheorien, die ebenfalls feministische Perspektiven integrieren und alle Arbeitsfelder und Aufgaben, die jenseits des Marktes liegen, miteinbeziehen. Hier finden sich realistischere Ansätze!
Die ökologische Ökonomie verwirft also das Modell des rational handelnden „homo oeconomicus“?
Natürlich! Das Ziel des homo oeconomicus ist es, Profite anzuhäufen. Die Wirtschaft soll so gestaltet werden, dass die Menschen schneller funktionieren: Mehr Geschwindigkeit, mehr Produktivität, mehr Geld und daher mehr Profit. Aber was bedeutet es, produktiver zu sein, wenn ich mit meinem Sohn das Geschirr spüle und wir dabei eine spannende Diskussion führen? Das Ziel war hier eher, einen spannenden Austausch zu haben und nicht, so schnell wie möglich abzuwaschen.
Wenn wir versuchen, Bereiche auszuwerten, die sich quantitativ schlechter erfassen lassen, stossen wir schnell an methodische Probleme. Existieren Indikatoren, mit denen sich die Arbeit ausserhalb des Marktes messen lässt?
In einer so rationalen Gesellschaft wie der unsrigen, hat alles, was sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt, keinen Wert, was natürlich falsch ist. Es gibt einige Indikatoren, um Nichterwerbsarbeit zu messen, aber die sind alle nicht unproblematisch. Es gibt etwas Studien darüber, wie viel Zeit wir für die Hausarbeit verwenden. Allerdings versuchen diese Studien, ebendiese Arbeit in abstrakten Zahlen auszudrücken und Aktivitäten miteinander zu vergleichen, die tatsächlich sehr verschieden sind. Ich sage mir oft, dass es spannend wäre, qualitative Indikatoren zu verwenden! Wenn wir beispielsweise Ländervergleiche anstellen, können wir untersuchen, wie sich die Menschen sich in den jeweiligen Ländern um die Bevölkerung kümmern. Dies würde uns Informationen geben, die den Menschen mehr ins Zentrum stellen, als dies bei der Gegenüberstellung der Brutoinnlandprodukte der Fall ist.
Sie haben das BIP als einen androzentrischen, also männerzentrierten Indikatoren bezeichnet. Warum?
Weil dieser Bereich eben die Produktivität derjenigen Aktivitäten ausdrückt, in denen die Männer nach wie vor vorherrschend sind: Lohnarbeit im Rahmen des Arbeitsmarktes. Lohnarbeit wird nach wie vor mehr mit Männern assoziiert, und nur weil wir uns als Frauen angestrengen, auch einen Teil davon zu sein, heisst das noch lange nicht, dass die männliche Bevölkerung und die Gesellschaft als ganzes dies zur Kenntnis genommen hat. In diesem Sinne sind also sämtliche Indikatoren, die sich vor allem auf den Arbeitsmarkt beziehen, androzentrisch.
In der Forschung der feministischen Ökonomie spielt das Paar „Arbeit“ und „Zeit“ eine wichtige Rolle. Was für Folgen hat die Tatsache, dass unsere soziokulturellen Normen den Begriff „Zeit“ vor allem unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität (von Arbeitsstunden) begreifen?
Die quantifizierte Zeit in Form von Arbeitsstunden ist ds Ergebnis der Industrialisierung. In früherer Zeit war es sowohl in ruralen als auch ländlichen Gegenden anders. Die verschiedenen Aufgaben wurden durch den Rhythmus der Natur und der Tageszeiten bestimmt. Mit der Industrialisierung fängt das Zeitalter der Uhren an; Zeitmessung, „Zeit ist Geld“, der Wunsch, keine Zeit zu verlieren usw.
Die Zeit wurde also an wirtschaftliche Profite gekoppelt?
Unter den aktuellen Verhältnissen wird jedes Unternehmen versuchen, seine Arbeitskraft noch mehr auszubeuten, um noch mehr Profite (in kürzerer Zeit) zu erwirtschaften. Die Unternehmen erhöhen aber ihre Profite auch dadurch, dass sie Frauen ausbeuten, die zuhause arbeiten. Denn es ist ihre Arbeit, die wiederum zur Reproduktion der Arbeitskräfte beiträgt, die dadurch zu einem niedrigen Preis ausgebeutet werden können. Natürlich wird auch die Natur ausgebeutet, weil die Unternehmen die Zeit, die die Natur zur Reproduktion erneuerbarer Ressourcen bräuchte, nicht respektiert. Die kapitalistische Ökonomie organisiert und kontrolliert also die Zeit in jeder Hinsicht.
Was würde es bedeuten, die Organisation von Zeit zu ändern?
Zuerst müssen wir unsere Produktions- und Konsumtionsweisen ändern. Unsere Produktion sollte nicht am Profit orientiert sein. Das heisst nicht, dass wir nicht von unserer Arbeit profitieren würden, aber wir müssten auf eine Art und Weise wirtschaften, die die Zeit der Natur respektiert. Es geht also darum, dass wir weniger Energie brauchen als wir dies im Moment tun. Und natürlich müssten wir auch die Zeit, die zur Pflege verwendet wird, respektieren. Die Frage der Zeit ist ein Schlüsselelement, denn um die Verwendung der Zeit zu ändern, müssen wir die ganze Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur von Grund auf verändern.
Weil sich also das kapitalistische System auf unseren Umgang mit der Zeit auswirkt, betrifft es gleichermassen unser Arbeitsleben sowie unser öffentliches und privates Leben.
Genau. Die kapitalistische Produktion könnte nicht existieren, ohne die natürlichen Ressourcen auszubeuten. Deswegen versuchen Anhänger der Ökologiebewegung auch, den Begriff „Produktion“ zu vermeiden. Denn eigentlich produzieren wir selbst nichts, sondern wir transformieren die Natur. Im Rahmen dieser Transformation zerstören wir die Natur auch, wenn wir materielle Güter aus ihr erschaffen. Auch der Dienstleistungssektor, die Wissenschaft und der Pflegebereich hängen natürlich von dieser ökonomischen Tätigkeit ab, da sich jede Arbeitskraft zuhause reproduzieren muss. Ohne die ständige Transformation der Natur könnte also kein Unternehmen existieren. Aller Reichtum basiert auf Arbeit und natürlichen Ressourcen, aber in unserem System wird dieser Umstand oft nicht zur Kenntnis genommen oder bewusst verschleiert.
Sie sagten, dass die ökologische Ökonomie – zusammen mit der feministischen – die einzige sei, die den Rahmen des Marktes verlasse. Was haben also der ökologische und der feministische Ansatz gemeinsam?
Beide Formen der Ökonomie überschreiten den orthodoxen Rahmen der bürgerlichen Ökonomie und beinhalten Elemente, die jenseits des Marktes stehen und somit nicht quantifizierbar sind. Die Zeit, in der wir uns umeinander kümmern, hat keinen Preis und wir wollen auch nicht, dass dies der Fall wird. Für die ökologische Ökonomie sind die Preise von grosser politischer Bedeutung: Der Preis des Öls etwa hängt von Entscheidungen ab, teilweise von den Kosten und nicht der Produktion, denn Öl wird nicht produziert, sondern gefördert. Der ökologische und der feministische Ansatz haben viel gemeinsam. Beide versuchen Elemente zu thematisieren, die vom Kapitalismus verschleiert werden. Die bürgerlichen Wirtschaftswissenschaften befassen sich nur mit der Spitze des Eisbergs, während die von ihr verschleierten Elemente die Basis darstellen.
Auch wenn die Reproduktion und die Natur also zwei grosse Säulen unseres Systems darstellen, gehen die Ökologiebewegung und die feministische Bewegung aber nicht Hand in Hand…
Ich glaube, die grössten Differenzen bestehen darin, dass grosse Teile der Umweltbewegung zu wenig für die Wichtigkeit des Carebereiches sensibilisiert sind. Viele Umweltaktivist*innen finden es wichtiger, sich den „Problemen unseres Planeten“ zu widmen, anstatt sich mit dem vermeintlich sekundären Carebereich zu beschäftigen. Glücklicherweise ist das nicht bei allen der Fall, und gerade dort versuchen wir zusammenzuarbeiten, denn es ist klar, dass sich eigentlich alle, die „dagegen“ sind, zusammenschliessen sollten.
Also alle, die unter der Spitze des Eisberg sind…
Ja. Dazu gehören auch die neueren Ansätze wie kooperative Wirtschaftsformen, die solidarische Ökonomie, die Share-Economy usw. Aber wie gesagt, viele ignorieren die ganze Problematik der Carezeit. All das müsste diskutiert werden, verlangt Erfahrung, ist nicht immer einfach.
Sie sagen, dass es schwierig ist, Veränderungen innerhalb und durch die Institutionen zu bewirken, da diese ja keine Massnahmen zulassen, die sie selbst schwächen oder zerstören. Aber ebenso ist es schwierig, mittels Mobilisierungen und Protesten der Bevölkerungen langfristige und grundlegende Veränderungen zu bewirken.
Die Frage nach dem Systemwechsel ist sehr komplex. Jede Generation macht, was sie kann. Wir sollten über unsere Ziele im Klaren sein und kleine Aktionen durchführen, die in diese Richtung gehen. Wir wissen nie, welcher Weg zum Erfolg führen wird und manchmal nehmen Bewegungen Dynamiken an, die nicht absehbar sind!
Was ist entscheidend, wenn wir also kleine Schritte in die richtige Richtung gehen wollen?
Wir brauchen eine gut organisierte Gesellschaft. Insofern wir die feministische Ökologie wirklich verinnerlicht haben, können wir auf eine andere Weise handlungsfähig werden. Wenn wir Ökonomie unterrichten, geht es nicht darum, die feministische Ökonomie als einzelnes Kapitel abzuhandeln, sondern ständig andere Perspektiven auf die bürgerliche Ökonomie zu werfen. Die Bildungsinstitutionen spielen da eine wichtige Rolle. Wenn wir unsere Wahrnehmung der Welt wirklich graduell ändern, so geben wir das auch an die nächste Generation weiter. Das ist eine wichtige Aufgabe.
Können wir mit solch kleinen Veränderungen wirklich unser Ziel erreichen?
Die Geschichte der Menschheit ist komplex und das System, in dem wir leben, äussert mächtig. Doch durch die zunehmende Umweltzerstörung gräbt sich dieses System auch sein eigenes Grab. Ich weiss nicht, wie weit wir noch gehen können, bis irgendwann die Situation eintritt, in der wir alle in sklavenähnliche Zustände zurückfallen und nur noch eine Minderheit das Privileg hat, zu konsumieren. Aber es bringt nichts, sich düstere Zustände auszumalen und depressiv zu werden…
Was für ein System brauchen wir also?
Ich denke, das ist eine Frage, die von allen diskutiert werden muss. Ich kann nur einige Prinzipien nennen. Wir brauchen ein menschliches System, das sich am Leben orientiert, das sich um die Bevölkerung kümmert, das keine Differenzen und Ungleichheiten einführt. Ein System der Gegenseitigkeit und der Affektion. Die Organisation einer solchen Gesellschaft kann nur durch konkrete Erfahrungen entstehen. Wir müssen handeln, lernen, aber dabei auch einige grundlegenden Prinzipien respektieren.
Dieser Artikel erschien zuerst am 6. August auf der Seite eldiario.es. Die Fragen stellte Andrea Pérez. Übersetzung durch die Redaktion.
* Cristina Carrasco Bengoa forscht über Hausarbeit, Frauenarbeit, feministische Ökonomie sowie eine mögliche nicht-androzentrische (männerorientierte) Ökonomie. Sie hat das Werk «Con voz propia. La economie feminista como apuesta téorica y politica» mitherausgegeben.
Feminismus: „Eine feministische Ökonomie geht über die Gleichheit zwischen Frauen und Männern hinaus.“