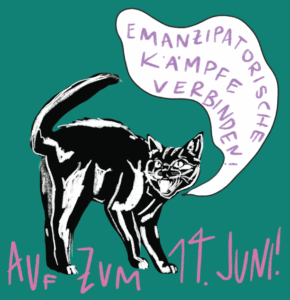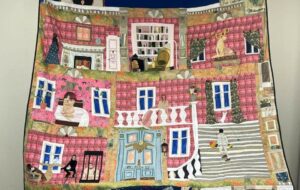Sara Hashemi ist 27 und studiert berufsbegleitend an der PH Zürich «Allgemeinbildung».
Wie erlebst du die Geschlechterverhältnisse in deinem Arbeitsalltag?
Früher habe ich in der Heilpädagogischen Schule Zürich gearbeitet, dort waren wir beinahe ausschliesslich Frauen. Auffallend war, dass den wenigen Männern, erstaunlich oft gedankt wurde, wenn sie beispielsweise Kinder wickelten, obwohl das für alle zum Job mit dazugehört.
An der Berufsschule sind wir etwa gleich viele Frauen wie Männer, jedoch unterrichten beinahe ausschliesslich Männer Berufskunde (es handelt sich um technische Fächer) und viel mehr Frauen ABU. Die Lernenden sind leider immer noch beinahe ausschliesslich männlich.
Im pädagogischen Bereich sind überdurchschnittlich viele Frauen* tätig – gerade in den unteren Schulstufen. Man spricht auch von einer «Feminisierung» dieser Berufe. Hat das Auswirkungen auf deinen Arbeitsalltag und deine Arbeitsbedingungen?
Ich habe einen Einblick erhalten in viele Schulstufen und bin in regem Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitstudierenden. Es zeichnet sich das klare Bild, dass je jünger die Kinder sind, desto weniger ernst wird die Lehrperson genommen. Kindergärtnerinnen bekommen leider immer noch oft zu hören, dass sie ja schon einen sehr schönen Job hätten, bei dem man einfach spielt mit den Kindern. Je höher die Schulstufe, desto mehr Ansehen gibt es, obwohl die Verantwortung, die man als Lehrperson hat, mit dem höheren Alter der Kinder stets abnimmt.
In der Berufsschule hatte ich einige Gespräche mit Lehrern, die mich besorgt gefragt haben, ob mich die Jugendlichen als so junge Frau denn ernst nehmen würden.
Werden Geschlechterverhältnisse im Bildungsbereich thematisiert? Gibt es eine Auseinandersetzung mit Themen wie Gleichstellung, Feminismus, Konstruktion von Geschlecht etc. im Lehrplan?
Laut Lehrplan 21 soll das Thema in NMG durchgenommen werden.
z.B NMG 1.6b: «Die SuS können vielfältige Geschlechterrollen beschreiben (z.B. in Beruf, Familie, Sport) und wissen, dass Mädchen/Frauen und Jungen/Männer dieselben Rechte haben.»
Oder NMG 16d: «Die SuS können Geschlechterrollen (z.B. Merkmale, Stereotypen, Verhalten) beschreiben und hinterfragen sowie Vorurteile und Klischees in Alltag und Medien erkennen.»
Wie das Thema behandelt wird steht und fällt natürlich mit der Lehrperson.
Am 14. Juni findet zweite grosse schweizweite Frauen*streik nach 1991 statt. Gerade für Lehrer*innen ist eine Beteiligung nicht gerade einfach. Hast du dir diesbezüglich schon Überlegungen gemacht?
Mein Problem am 14. Juni ist nicht, dass ich arbeiten müsste, sondern, dass dann eine der wichtigsten Prüfungen an der PH stattfindet. Im Moment sind wir dabei zu versuchen, diese Prüfung zu verschieben, allerdings erhoffe ich mir nicht all zu viel. Die PH ist nicht gerade für ihre Flexibilität bekannt.
Wieso wirst du am 14. Juni streiken?
Gründe zu streiken gibt es selbstverständlich viele. Bezogen auf unseren Beruf geht es mir besonders um die Anerkennung der Arbeit von Lehrpersonen der unteren Schulstufen. Es ist extrem stossend, dass KUst (Kindergarten Unterstufe) – Studierende die gleiche Ausbildung machen und mindestens die gleiche Belastung bei der Arbeit erleben, aber massiv viel weniger verdienen (ca. 800 Franken). Meiner Ansicht nach kann nicht geleugnet werden, dass dieser Lohnunterschied zumindest teilweise dadurch bedingt ist, dass es sich traditionell um einen Frauenberuf handelt.
Was muss der Frauenstreik fordern? Was sind deine feministischen Ziele?
Der Frauenstreik soll fordern, dass das Lohnniveau der Kindergarten – Lehrpersonen an die Primarstufe angepasst wird und dass an Schulen über Sexismus und dessen Folgen aufgeklärt wird. Mein persönliches Ziel ist es, dass niemand aufgrund des Geschlechts bzw. der Geschlechtsidentität diskriminiert wird.