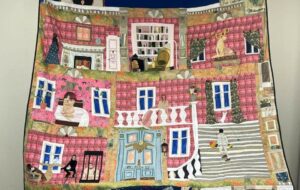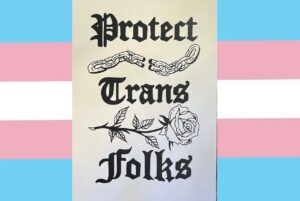Heute ist der 8. März. Wir schreiben das Jahr 2021. 1911, vor 110 Jahren demonstrierten das erste Mal weltweit Arbeiterinnen. Als Teil der sozialistischen Arbeiter:innenbewegung kämpften sie für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen und die Emanzipation von Patriarchat und Kapitalismus. Sie vereinigten sich gegen den immer aggressiver werdenden Nationalismus, sie forderten die politische Mitsprache. Sie etablierten den 8. März als internationalen Frauenkampftag. Und sie gaben dem Tag eine Geschichte, einen Entstehungsmythos: Sie beriefen sich auf einen wilden Streik von Textilarbeiterinnen in New York 1857, der blutig niedergeschlagen worden sei. Ein Jahr nach dem ersten weltweiten Frauenkampftag, 1912, streikten wiederum Textilarbeiterinnen: Ihre Parole – «bread and roses» – sollte in den nachfolgenden Jahrzehnten zu einer Hymne der feministischen, gewerkschaftlichen Bewegung werden. Fünf Jahre später, mitten in den grausamen Wirren des 1. Weltkriegs, waren es die Arbeiterinnen, die im Zuge ihrer Demonstration zum internationalen Frauenkampftag 1917 Brot und Frieden einforderten und damit die Russische Revolution auslösten. Das ist die Geschichte, auf die wir uns berufen, wenn wir vom 8. März als feministischem Kampftag sprechen – und nicht dessen Institutionalisierung durch die UNO 1975 zum Weltfrauentag und dessen (neueste) Kommerzialisierung durch Grosskonzerne und Shoppingcenters.
von Julie Müller (BFS Frauen/FTIQ Zürich)
50 Jahre feministische Errungenschaften
Mit dem von der Arbeiter:innenbewegung erkämpften Ende des 1. Weltkriegs und der nachfolgenden Niederschlagung der revolutionären Erhebungen wurde in einigen Ländern das von der Frauenbewegung geforderte Frauenwahlrecht eingeführt. Nicht so in der Schweiz: Obwohl während des Generalstreiks 1918 diese Forderung an prominenter zweiter Stelle stand, wurde sie – wie auch zum Beispiel die AHV – von Parlament und Regierung bewusst lange verschleppt und noch Jahrzehnte später von der (männlichen) Stimmbevölkerung abgelehnt.
1971 – ja, wir feiern erst ein 50-Jahr-Jubiläum – wurde es dann endlich von einer Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Männer auf Bundesebene angenommen. Obwohl sich damit die mehrheitlich bürgerlich geprägte Frauenstimmrechtsbewegung am Ziel wähnte, wurden kritische Stimmen laut: Die Gleichberechtigung sei noch meilenweit entfernt, solange die strukturelle Unterdrückung aufgrund des Geschlechts andauere, protestierte die Neue Frauenbewegung der 1970er-Jahre, denn: «Das Private ist politisch!» Die politische Mitsprache war also kein Endpunkt feministischer Politik, sondern eine viel zu lang vorenthaltene Zwischenetappe.
Die marxistisch-sozialistischen und autonomen Feministinnen sollten (natürlich) Recht behalten; die politischen Rechte brachten noch lange keine Gleichberechtigung. Eine Volksinitiative wollte diesen Anspruch auf Verfassungsebene verankern. Grosse Teile der Neuen Frauenbewegung unterstützten die Initiative – auch ausserparlamentarisch orientierte Kräfte, denn der Entwurf enthielt auch eine Elternzeit, was die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Privaten, als ein Sockel des Patriarchats, zumindest teilweise infrage stellte.
1981 angenommen wurde aber der bundesrätliche Gegenvorschlag, in dem sowohl die Elternzeit als auch die fünfjährige Umsetzungsfrist der Gleichstellung gestrichen worden war. Dem Vorstoss waren somit auch die letzten Zähne gezogen worden; Frau und Mann waren nun zwar gleichberechtigt und hatten insbesondere Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit (was gemäss der International Labour Organisation schon lange ein Grundrecht von Arbeiter:innen war) – nur, es fehlte die gesetzliche Grundlage, um diese ‘Gleichstellung’ einzuklagen.
Ganz in der Tradition des feministischen Geschichtsbewusstseins beriefen sich Gewerkschafterinnen und Aktivistinnen auf ihre ökonomische Schlagkraft. Zu viele Lohnklagen waren abgewiesen worden, zu viele Ungleichheiten bestanden fort, zu viele Leben wurden zerstört durch patriarchale Gewalt.
1991, am 14. Juni, ging der erste Frauenstreik in der Schweiz als grösste Massenmobilisierung seit dem Generalstreik 1918 in die Geschichtsbücher, Köpfe und Herzen ein. Die Streikenden sangen «bread and roses» und zeigten zugleich mit ihrer Vernetzung und ihren Forderungen die Entwicklungen innerhalb der feministischen Bewegung auf: Das politische Subjekt ‘Frau’ wurde in Bezug auf Herkunft, ‘race’, Klasse, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität zunehmend intersektional gedacht, was das Verdienst mühevoller Anstrengungen von Betroffenen war, die sich trotz Marginalisierung selbst organisiert hatten. Die Forderungen des Streiks waren ebenso vielfältig, wie drängend – und sind heute fast durchwegs so aktuell wie vor dreissig Jahren. Nicht zuletzt, weil die Forderungen reaktionär gekontert wurden durch Sparmassnahmen, neoliberalen Umbau und den Aufstieg der rechten SVP, infolge der heftigen Rezession der frühen 1990er-Jahre. Obwohl Frauen, Lesben, inter, nonbinary und trans Personen am stärksten von Krise und Arbeitslosigkeit und in der Folge auch von Gewalt und Prekarisierung betroffen waren, brauchte die feministische Bewegung in der Schweiz knapp drei Jahrzehnte und – wie schon vor hundert Jahren – die Schubkraft internationaler Mobilisierungen, um zu neuer, alter Stärke und Präsenz zu finden.
8M2021 – Ein Weckruf!
2021, zwei Jahre nach dem gigantischen kämpferischen feministischen Streik/Frauen*streik 2019, steht bereits der zweite 8. März im Zeichen der Pandemie. Ein schwieriges Jahr für Jubiläen; Jubiläen, die uns aber genau jetzt wachrütteln sollten.
Vor gut einem Jahr stellten wir (alle) fest, dass der Umgang mit der ‘Corona-Krise’ ein geschlechtsspezifischer ist, weil er die durch die neoliberale Politik der letzten Jahrzehnte verschärfte Care-Krise zeige. Es war zwar «schon vor Corona Notstand», doch das in Jahresfrist Erlebte legt die unterschiedlichen Betroffenheiten von Patriarchat und Kapitalismus offen. Das Offensichtliche, dass die Verwundbarkeit in der Pandemie (auch) entlang von Klassen- und Geschlechterzughörigkeit sowie Rassifizierung bemessen ist, steht in keinem Verhältnis zu den staatlichen Massnahmen. Die scheinbare ‘neue’ Normalität, dass Menschenleben gegen Kapitalinteressen abgewogen werden, wurzelt in der ‘alten’ Normalität, setzt diese fort und verschärft die Unterdrückungsformen, insbesondere entlang sexualisierter Gewalterfahrung und geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung.
Der vielbeschworenen, plötzlich anerkannten ‘Systemrelevanz’ der sozialen Reproduktion folgt aber weiterhin keine materielle Aufwertung des Gesundheits- oder Betreuungswesens. Denn die soziale Reproduktion wird, als die Arbeit, die es braucht, um Menschenleben zu erhalten, vor allem von Frauen, Lesben, inter, nonbinary und trans Personen unter- und unbezahlt geleistet. Gerade weil uns die politische Mitsprache bis heute weder tatsächliche Gleichstellung noch Brot oder Rosen gebracht hat, gerade weil wir die Folgen von Pandemie und Krise (er-)tragen müssen, sollten wir diesen 8. März 2021 als geschichtsträchtigen Moment begreifen.
1991, nach der bis dato grössten, gesellschaftspolitisch radikalen feministischen Massenmobilisierung in der Schweiz, hat die Wirtschaftskrise die Hoffnung auf bald erreichte Emanzipation unter sich begraben. Die Folgen der Krise und die Sparmassnahmen trafen Frauen, Lesben, inter, nonbinary und trans Personen besonders: Anstatt dass die vielfältigen feministischen Forderungen umgesetzt worden wären, begann ein Abwehrkampf gegen rechts um die Verteidigung von bereits Erstrittenem und die Verhinderung weiterer Prekarisierung. Der feministische Aufbruchsmoment war gebrochen.
Auch jetzt warten am mit Impfplänen und Lockerungsforderungen verklärten Horizont Sparprogramme, mit denen wir Lohnabhängige die Coronahilfe für (Gross-)Unternehmen, Steuergeschenke an die Reichen und die Kosten für die steigenden Sozialkosten im Zuge der Umverteilung nach oben bezahlen sollen.
Nehmen wir diesen 8. März im Jahr der Jubiläen, im Jahr der Krise, als Weckruf, dass wir nach dem zweiten feministischen Streik stärker sind denn je! Trotz der patriarchalen Repression, die der feministischen Bewegung auch als ausserordentlich brutale Polizeigewalt entgegenschlägt, werden wir, im Bewusstsein unserer Geschichte nicht zulassen, dass uns dieser erneute Aufbruchsmoment genommen wird. Wir kämpfen gegen die Abwälzung der Kosten und reproduktiven Konsequenzen auf unsere Schultern, wir kämpfen für eine solidarische Gesellschaft! Wir fordern «bread and roses», wir fordern Gleichheit in der Differenz, wir fordern Reproduktion vor Produktion! Wir schreiben unsere Geschichte weiter, seit hundert Jahren am 8. März, seit dreissig Jahren am 14. Juni – wir sind nicht kleinzukriegen! Wir haben ausgesorgt – feministische Revolution sofort!