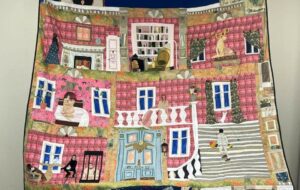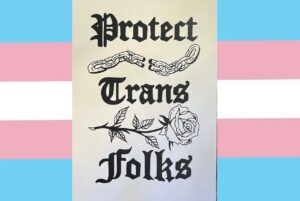«Als systemrelevant werden Unternehmen oder Berufe bezeichnet, die eine derart bedeutende volkswirtschaftliche oder infrastrukturelle Rolle in einem Staat spielen, dass ihre Insolvenz nicht hingenommen werden kann» so steht es auf Wikipedia. Bemerkenswert ist, dass es alleine um die volkswirtschaftliche und infrastrukturelle Rolle geht. Wo aber bleiben die Menschen? Soziale Beziehungen, Gesellschaft und Gemeinschaft ist so vieles mehr als nur Wirtschaft. Wenn wir also von Systemrelevanz sprechen, muss logischerweise das Pflegen von sozialen Beziehungen, das Kümmern um hilfsbedürftige Menschen, das Zur-Welt-Bringen und Aufziehen von Kindern und die Sorge um die Natur als Grundlage für das menschliche Leben mitgedacht werden. Mehr noch: Dies sind die eigentlich relevanten Tätigkeiten – relevant für ein gemeinschaftliches und nachhaltiges Leben.
von BFS Frauen*/FTIQ
Im Kapitalismus werden diesen Tätigkeiten aber lediglich eine untergeordnete Rolle beigemessen. Es geht primär um die Aufrechterhaltung des Wirtschaftssystems, des Konkurrenz- und Profitzwangs. Doch auch wenn die Arbeiten der Pflege und Fürsorge (die Care-Arbeit) im Kapitalismus abgewertet werden: damit dieses System weiterhin bestehen kann, sind sie unvermeidbar. Damit der Wirtschaft genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, müssen zum einen genug Arbeiter*innen gemacht werden, zum anderen müssen diese Arbeiter*innen auch ständig wieder mit Energie versorgt werden, sodass sie auch jeden Tag wieder ihre Arbeitskraft verkaufen können. Die Arbeitskräfte müssen also ständig produziert und reproduziert werden
Die soziale Reproduktion
Zur Produktion von Arbeitskräften zählt nicht nur das Gebären von Kindern, sondern ebenso deren Erziehung zu Arbeiter*innen. Zur Reproduktion von Arbeitskräften gehört genug Nahrung, wenn es gut kommt ein Dach über dem Kopf, Gesundheitsversorgung und so weiter. Es sind unzählige Tätigkeiten, die es überhaupt möglich machen, dass tagtäglich Millionen von Menschen zur Arbeit gehen und Mehrwert schaffen. Und die Kapitalist*innen haben ein Interesse daran, dass diese Reproduktionsarbeit möglichst günstig verrichtet wird.
Vereinfacht gesagt: Ein*e Kapitalist*in muss so viel Profite wie möglich erzielen, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Gleichzeitig braucht sie Menschen, die die Arbeit verrichten: Arbeiter*innen. Diese müssen gewisse Grundbedürfnisse befriedigen können, um überhaupt arbeiten zu können. Und das Befriedigen dieser Grundbedürfnisse ist meist nicht rentabel, zumindest kurzfristig nicht. Der Bevölkerung wirklich gute Gesundheit zu garantieren, ist nicht rentabel. Allen möglichst reichhaltige und ausreichend Nahrung zu garantieren, ist nicht rentabel. Für die Erhaltung der Natur und der Biodiversität zu sorgen, ist nicht rentabel. All diese Dinge sind nicht rentabel, weil eine ausgebeutete Arbeiter*innenklasse nicht dafür bezahlen kann. Und im Kapitalismus werden nur zahlungskräftige Bedürfnisse befriedigt. Es ist also eine Gratwanderung: Wenn die Kapitalist*innen von ihren Profiten gar kein Geld ausgegeben, um die Arbeiter*innenklassse zu (re)produzieren, wird es bald zu wenig Arbeitskräfte geben. Wenn viel Geld ausgegeben wird, sinkt ihr Anteil an den Profiten. So sehen wir in der Geschichte des Kapitalismus ein ständiges Kräfteringen darum, wer für die (Re)produktion des Grossteils der Menschen aufkommt – es ist ein Teil des Klassenkampfs.
Die Einführung und der Ausbau der öffentlichen Dienste sind das Resultat von sozialen Kämpfen, die zugunsten der Arbeiter*innenklasse ausgegangen sind. Doch in den letzten 40 Jahren Neoliberalismus konnte diese Auseinandersetzung zunehmend zugunsten des Kapitals entschieden werden. Öffentliche Dienste wurden abgebaut, Schulen, Spitäler, öffentlicher Verkehr usw. wurden privatisiert. Sobald diese Bereiche in die private Marktwirtschaft eingebunden wurden, wurde versucht, Profite damit zu machen. Im Gesundheitswesen hat das mittels Fallpauschalen und schlechteren Arbeitsbedingungen zumindest vorübergehend «funktioniert». Eigentlich führte es aber zu einer Verschlechterung für alle – Arbeiter*innen und Nutzer*innen. Das zeigte sich nun während Corona. Einhergehend mit diesen Privatisierungen und Kürzungen wurden immer mehr Tätigkeiten der sozialen Reproduktion wieder in die häusliche Sphäre verlagert. Ein Beispiel dafür sind blutige Entlassungen aus Spitäler. Die Patient*innen müssen dann im Privaten gesundgepflegt werden. Das bedeutet neben immer prekären werdenden Arbeitsbedingungen in feminisierten Berufen auch mehr unbezahlte Hausarbeit für Frauen*.
Eine kleine Geschichte feminisierter Arbeit
Die Arbeit der sozialen Reproduktion – ob bezahlt oder unbezahlt, ob im privaten oder öffentlichen Bereich – wird nämlich als weiblicher Aufgabenbereich naturalisiert und denjenigen Personen zugeschrieben, die als weiblich gelesen werden [1]. Es wird von Frauen* aber nicht nur erwartet, dass sie Care-Arbeit im privaten Raum unbezahlt machen, sondern sie sollten dazu auch noch ihre Arbeitskraft verkaufen (was natürlich auch eine Errungenschaft feministischer Kämpfe ist, im Kapitalismus aber zu Doppelbelastungen geführt hat). Die gesellschaftliche Vorstellung davon, dass Frauen* «von Natur aus» emotionaler und emphatischer seien und sowieso besser pflegen, sorgen und betreuen könnten als Männer*, übertrug diese gesellschaftliche Arbeitsteilung auch auf den Arbeitsmarkt, wo Männer* bis heute in den Chefsesseln sitzen, während Frauen* tendenziell in der Pflege, der Betreuung, oder dem Detailhandel arbeiten – in sogenannten feminisierten Berufen. Diese Berufe wurden und werden ständig abgewertet: Es heisst zum Beispiel, Frauen* könnten sowieso besser auf Kinder aufpassen oder Kranke pflegen und bräuchten dafür keine sonderliche Ausbildung oder Anerkennung.
Care-Arbeit und Kapitalismus während Corona
Wir haben während der Corona-Krise gesehen und gespürt, wie wichtig die Arbeit der sozialen Reproduktion für unsere Gesellschaft ist. Es wäre ja nur logisch, diese Arbeit nun auch gut zu bezahlen, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und diese Bereiche nicht nach der Profitlogik auszurichten. Doch dies wird nicht geschehen. Denn das kapitalistische System funktioniert auch nach Corona immer noch nach der Logik des Profitzwangs und des Wettbewerbs und ist auch nach Corona noch darauf angewiesen, möglichst wenig Geld für die soziale Reproduktion der Arbeiter*innenklasse auszugeben, alles andere würde massive Verluste für die Kapitalist*innen bedeuten. Und da einige Zugeständnisse an die Gesundheit der Arbeiter*innenklasse gemacht werden mussten, waren die Gewinne nicht so hoch, wie erwünscht. Und auch die Arbeitslosenzahl hat massiv zugenommen, was weitere Kosten bedeutet. Doch anstatt die Steuern für die Reichen (die notabene während Corona zum Teil noch reicher wurden) zu erhöhen, werden diese Kosten nun auf die Allgemeinheit abgewälzt – Gewinne werden privatisiert, Kosten werden abgewälzt. Es wird also eher zu weiteren Sparprogrammen kommen als zu guten Löhnen für alle. Denn der Fakt, dass einige wenige enormen Reichtum besitzen, während viele nichts besitzen, wird nicht angetastet werden. Statt einer Umverteilung wird es heissen «Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen». Und diese Sparprogramme werden wieder genau diese Bereiche treffen, in denen das Kapital möglichst wenig Geld ausgeben will, weil diese Bereiche nicht rentabel sind: Bildung, Gesundheit, öffentlicher Verkehr, Sorge und Pflege.
Lasst uns Streiken
Wir müssen verstehen, dass das kapitalistische System ohne die tagtäglich von Frauen* verrichtete (Re)produktionsarbeit zusammenfallen würde. Wir müssen verstehen, dass Frauen* durch doppelte Arbeitstage, prekärer Situation und miserablen Arbeitsbedingungen das System aufrechterhalten. Das heisst im Umkehrschluss, dass wir dieses System nur aufhalten können, wenn wir unsere Arbeit stoppen.
Lasst uns streiken für den Ausbau des öffentlichen Dienstes und für Arbeitszeitverkürzung – sodass die gesellschaftliche Care-Arbeit fair aufgeteilt werden kann. Lasst uns streiken gegen die Ökonomisierung in den wirklich relevanten Tätigkeiten und für die Überführung von Bildung, Gesundheit und Betreuung in die öffentliche Hand – unter Kontrolle der Beschäftigten und Nutzer*innen.
Flyertext der BFS FTIQ*/Frauen Zürich für den 14. Juni 2021.
[1] Wir schreiben von Frauen*, wenn weiblich gelesene Personen gemeint sind. Der Stern steht dafür, dass diese Zuschreibung sozial konstruiert.