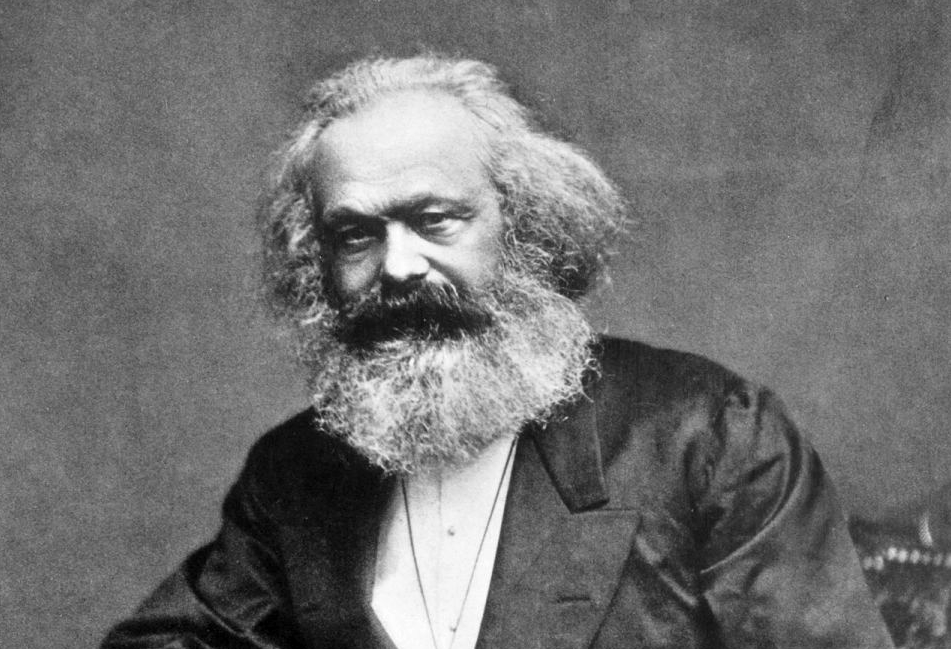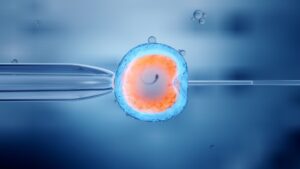Seit einiger Zeit wächst die Kritik am Kapitalismus und das Interesse, seine Funktionsweise möglichst gut zu verstehen, um ihn überwinden zu können. Da ist es naheliegend, nicht auf irgendwelche Sekundärquellen, sondern auf das ‚Original‘ der Kapitalismus-Kritik, auf Marx’ Kapital, zurückzugreifen.
von Johann-Friedrich Anders; aus die Internationale
Genau diesen Weg gehen die Kapital-Studium-Kurse, die seit einigen Jahren wieder Konjunktur haben. Aber ist dieser Weg zielführend? Wer ein Interesse am Verstehen unserer physikalischen bzw. biologischen Welt hat, würde keineswegs nach Newtons HauptwerkPhilosophiae Naturalis Principia Mathematica (lateinische Erstausgabe 1687) bzw. nach Darwins On the Origin of Species by Means of Natural Selection (Erstausgabe 1859) greifen, sondern nach einem Lehrbuch der Physik bzw. der Evolutionsbiologie. Gibt es gute Gründe dafür, dass beim Studium des Kapitalismus ein Vorgehen praktiziert und empfohlen wird, das in Bezug auf die physikalische bzw. die biologische Welt nur Kopfschütteln auslösen würde?
Die Argumentation der Befürworter*innen des Kapital-Studiums
Michael Heinrich z.B. beantwortet in Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung die Frage, warum man heute Das Kapital studieren soll, folgendermaßen:
„Offensichtlich kommt man auch heute nicht um das Marxsche ‚Kapital‘ herum, will man sich grundsätzlich mit dem Kapitalismus auseinandersetzen.“ „Im ‚Kapital‘ werden zentrale Teile eines Basiswissens bereitgestellt, das für eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen notwendig ist.“
Nun tauchen beim Kapital-Studium bekanntlich schnell Verständnisprobleme auf. So heißt es etwa bei Heinrich: „Beginnt man das ‚Kapital‘ zu lesen, stößt man auf einige Schwierigkeiten. Gerade am Anfang ist der Text nicht immer ganz einfach zu verstehen. Abschreckend dürfte auch der Umfang der drei Bände wirken.“
Zur Lösung des Verständnisproblems, an dem das Studium des Kapital nicht selten scheitert, bietet nicht nur Heinrich Lesehilfen an. Diese Lesehilfen sollen dazu beitragen, die Schwierigkeiten des Kapital-Studiums zu überwinden. Sie sollen aber keineswegs das Studium des Kapital im Original ersetzen. Heinrich über seine Lesehilfen Wie das Marxsche ‚Kapital’ lesen?: „Der Kommentar dient nicht dazu, sich einen schnellen Überblick über den Anfang des ‚Kapital‘ zu verschaffen, er ist vielmehr ein Arbeitsbuch, d.h. es soll mit ihm und dem ‚Kapital‘ gearbeitet werden.“
Warum das systematische Kapital-Studium nicht zielführend ist
1. Es ist nicht notwendig
Heinrich u. a. setzen die Kenntnis der Kapitalismus-Theorie gleich mit der Kenntnis des Kapital. Zweifellos ist die Kenntnis der im Kapital entwickelten Kapitalismus-Theorie nötig, um den Kapitalismus zu verstehen; jedoch keineswegs die Kenntnis des Werkes, in dem diese Theorie in ihren Grundzügen erstmals entwickelt wurde. Das wusste schon der ‚Arbeiterphilosoph‘ Joseph Dietzgen, der 1869 in seinem Buch Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit. Dargestellt von einem Handwerker. Eine abermalige Kritik der reinen und praktischen Vernunft schrieb:
„Was die Wissenschaft der Vergangenheit Positives produzierte, lebt nicht mehr im Buchstaben seines Autors, sondern ist mehr als Geist, ist Fleisch und Blut geworden in der gegenwärtigen Wissenschaft. Um z.B. die Produkte der Physik zu kennen und dazu Neues zu produzieren, ist es nicht erforderlich, erst die Geschichte dieser Wissenschaft zu studieren und die bisher entdeckten Gesetze an der Quelle zu schöpfen. Im Gegenteil, die geschichtliche Forschung dürfte der Lösung einer bestimmten physischen Aufgabe nur hinderlich sein, indem die konzentrierte Kraft notwendig mehr leistet als die geteilte.“
Wer nach der physikalischen Erklärung der Welt sucht, der greift nach einem aktuellen Lehrbuch der Physik und nicht nach Newtons Principia. Und einfach nur befremdlich wäre die Empfehlung von Büchern mit Titeln wie: „Wie Newtons Principia mathematica lesen? Leseanleitung und Kommentar zu den Principia“. Selbst eine so klare und verständliche – und insofern klassische – Darstellung wie die von Darwin in On the Origin of Species by Means of Natural Selection von 1859 ist, wie sich von selbst versteht, keine systematische Darstellung des aktuellen Stands der Darwin’schen Theorie.
2. Lesehilfen lösen das Verständnisproblem nicht
Heinrich empfiehlt zum Studium die drei von Engels herausgegebenen Bände des Kapital (die MEW-Bände 23–25) als „eine lesbare Ausgabe …, die auch heute nocheinen ersten Einstieg ermöglicht.“ Und welche Texte von Marx wären als Fortsetzung dieses „ersten Einstieg(s)“ zu studieren? Die Kapital-Bände der zweiten historisch-kritischen MEGA-Ausgabe, also die 15 Bände in 23 Teilbänden? Aber auch dann hätte man noch fast nichts von der Marx’schen Staatstheorie zur Kenntnis genommen, ohne die aber das Marx-Verständnis sehr unvollständig bleibt, wie Heinrich erklärte: „Im ‚Kapital‘ finden sich lediglich vereinzelte Bemerkungen zum Staat. Kapitalkritik ist aber ohne Staatskritik nicht nur unvollständig, sie lädt zu Missverständnissen geradezu ein.“Und wie viele Bände Lesehilfen wären erforderlich, um auch nur die drei Bände des Kapital (in der MEW-Ausgabe 955, 559 und 1007 Seiten) einigermaßen zu verstehen? Reichte der eine Band Lesehilfe von Altvater, der allerdings nur den Band I des Kapital behandelt? Oder die zwei Bände Lesehilfen von Haug (198 und 270 Seiten)? Oder die (bisher) zwei Bände von Heinrich Wie das Marxsche „Kapital“ lesen? Leseanleitung und Kommentar zum Anfang des „Kapital“, die allerdings nur die ersten 5 Kapitel der 25 Kapitel des ersten Bandes des Kapital behandeln?
3. Was kein Kapital-Studium leistet: die Analyse der Gegenwart
Eine weitere Kritik am Kapital-Studium bringen die Kapital-Studium-Befürworter*innen wie Heinrich indirekt selbst vor: „(M)an darf die analytische Reichweite des ‚Kapital‘ […] nicht überschätzen.“ Denn: „Die Marxsche Argumentation ist auf einer sehr abstrakten Ebene angesiedelt“. „Was Marx darstellen will, ist […] die kapitalistische Produktionsweise ‚in ihrem idealen Durchschnitt‘ (MEW 25, S. 839). Es geht ihm um das, was den Kapitalismus zum Kapitalismus macht.“ Das Marx’sche Kapital „kann daher keine bereits erschöpfende Analyse des jeweils interessierenden historischen Kapitalismus sein, die lediglich durch ein paar aktuelle Daten zu ergänzen wäre. Um die Entwicklungstendenzen des gegenwärtigen Kapitalismus zu verstehen, ist noch weit mehr an Analyse nötig(,) als man im ‚Kapital‘ findet.“
Offenkundig ist also selbst für Kapital-Studium-Verfechter*innen das Kapital-Studium nicht ausreichend für das Ziel, zu dem sie unternommen wird – für das Verstehen des gegenwärtigen Kapitalismus, das anscheinend von allen Kapital-Studium-Kursen immer wieder neu geleistet werden muss.
Angesichts der dargestellten Schwierigkeiten stellt sich die Frage, ob nicht die Lektüre eines aktuellen marxistischen Lehrbuchs eine sinnvolle Alternative zum Kapital-Studium wäre. Könnten Lehrbücher nicht die zwei Probleme jedes Kapital-Studiums lösen: die Verständnisschwierigkeiten beim Studium des Marx’schen Originals und das Fehlen einer Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus?
Marxistische Lehrbücher – eine Alternative zum Kapital-Studium?
1. Heinrichs prinzipielle Kritik an Lehrbüchern
Verfechtern des Kapital-Studiums zufolge ist das Studium eines Lehrbuchs der marxistischen politischen Ökonomie kein gangbarer Weg, keine Lösung der mit dem Kapital-Studium verbundenen Probleme.
Heinrich z.B. nennt zwei Gründe, warum eine Lehrbuch-Darstellung der Marx’schen Theorie ungeeignet sei: „Jede derartige Zusammenfassung ist mit ihren Betonungen und Auslassungen von den Einschätzungen des jeweiligen Autors geprägt. Zu einem eigenen Urteil über das Originalwerk kann man nur aufgrund eigener Lektüre kommen. Darüber hinaus kann aber auch die beste Einführung nur Resultate benennen. Die Begründungen dieser Resultate können nur angedeutet werden.“
- Unvermeidlich ist jede Wiedergabe eines Werks subjektiv. Das muss aber keineswegs ein Nachteil sein. Ganz im Gegenteil: Sie kann verständlicher sein als das Original; denn sie steht nicht mehr vor der schwierigen Doppel-Aufgabe, neue Ideen zu entwickeln und sie klar und verständlich darzustellen. Sie ist nur noch mit dem Darstellungsproblem befasst.
- Ist das Ziel der Lektüre wirklich, wie Heinrich formuliert, ein „eigenes Urteil“ über das Marx’sche Kapital? Nicht das Verstehen der im Marx’schen Kapital erstmals in ihren Grundzügen entwickelten Theorie?
- Warum schließlich sollten „Begründungen von Resultaten“ in Lehrbüchern nur „angedeutet“ werden können? Warum sollten in einem Lehrbuch ausführliche Begründungen da, wo sie für das Verständnis nötig sind, nicht möglich sein?
2. Sind Popularisierungen unvermeidlich eine Verfälschung?
Es gibt verschiedene kurzgefasste, einfache Darlegungen der Marx’schen Theorie, die Marx bzw. Engels verfasst haben. Zwei dieser von Marx geschriebenen populären Darlegungen seiner ökonomischen Theorie – Lohnarbeit und Kapital (1847) und Lohn, Preis und Profit (1865) – hat Heinrich kritisiert:
„… auch einfachere ‚ökonomische‘ Texte von Marx, wie ‚Lohnarbeit und Kapital‘ oder ‚Lohn, Preis, Profit‘, sind als Vorbereitung auf das ‚Kapital‘ nicht geeignet. Die erste Schrift beruht auf Vorträgen, die lange vor dem ‚Kapital‘ verfasst wurden, und die daher noch nicht auf dessen Erkenntnisstand argumentieren. Die zweite Schrift beinhaltet einen Vortrag, den Marx niederschrieb, während er bereits am ‚Kapital‘ arbeitete, den er aber nur sehr widerwillig verfasste, weil er wusste, dass er zu einer Reihe von problematischen Vereinfachungen gezwungen war. Statt sich zuerst mit solchen unzureichenden Darstellungen zu beschäftigen, sollte man besser ohne Umwege gleich mit dem ‚Kapital‘ beginnen.“
Zweifellos hatte Marx 1847 noch nicht den Erkenntnisstand, den er mit dem Kapital erreichte, als er die 1849 unter dem Titel Lohnarbeit und Kapital19 veröffentlichten Vorträge 1847 im Brüsseler deutschen Arbeiterverein über die Fragen hielt: Was ist der Arbeitslohn? Wie wird er bestimmt? und: Wodurch wird der Preis einer Ware bestimmt? Und auch 1849 noch nicht, als er diese Vorträge veröffentlichte. Aber bekanntlich liegt diese Schrift in einer Ausgabe von 1891 vor, in der Engels den Begriff „Arbeit“ durch „Arbeitskraft“ ersetzt hat. Damit hatte Engels den Text auf Marx’ späteren Erkenntnisstand gebracht.
Heinrichs weitere Behauptung, dass Marx seinen Vortrag Lohn, Preis und Profit von 1865 „nur sehr widerwillig verfasste“, und zwar, „weil er wusste, dass er zu einer Reihe von problematischen Vereinfachungen gezwungen war“, dürfte mit Marx’ eigenen Aussagen kaum in Einklang zu bringen sein:
Am 20. Mai 1865 wurden im Zentralrat der I. Internationale die von dem Mitglied des Zentralrats John Weston vorgebrachten ökonomischen Behauptungen diskutiert, dass eine Erhöhung der Löhne nutzlos sei und die Gewerkschaften schädlich seien. Marx beteiligte sich an dieser Diskussion. Vor der Diskussion im Zentralrat schrieb Marx an Engels: Es ist „nicht leicht, alle die ökonomischen Fragen, die dabei konkurrieren, Ignoranten auseinanderzusetzen. You can’t compress a course of Political Economy into 1 hour. But we shall do our best. …”
Marx arbeitete dann einen Vortrag zu den strittigen Fragen aus, den er in englischer Sprache am 20. und 27. Juni 1865 vor dem Zentralrat hielt. Über diesen Vortrag schrieb Marx am 24. Juni 1865 an Engels: „… Ich habe in dem Central Council ein paper gelesen (was vielleicht zwei Bogen im Druck machen würde) über die von Mr. Weston eingebrachte Frage, wie a general rise of wages etc. wirken würde. Der erste Teil davon Antwort auf Westons Blödsinn; der zweite a theoretical Auseinandersetzung, soweit Gelegenheit passend dazu. … das Ding enthält im zweiten Teil, in außerordentlich gedrängter, but relatively popular form, viel Neues, das aus meinem Buch vorweggenommen ist, während es zugleich doch notwendigerweise über allerlei wegschlüpfen muß. …“
Sicherlich hätte Marx, wie von Heinrich für erforderlich gehalten, die von ihm behandelte Problematik differenzierter darstellen können. Aber wäre das angebracht gewesen? Marx’ Vorträge waren, wie mir scheint, problem- und adressatenadäquate Popularisierungen und sicherlich keine Verfälschung der originalen Theorie.
Heinrichs prinzipielle Kritik an Lehrbüchern, sie seien vereinfachende, verkürzte, unvollständige, selektive, kurz: popularisierende Darstellungen, ist seltsam. Lehrbücher werden, wenn nötig, kritisiert, weil sie schlecht gemacht, schwer verständlich, fehlerhaft, lückenhaft sind oder neue Erkenntnisse nicht berücksichtigen. Solche Kritik sagt aber nichts gegen den grundsätzlichen Wert von Lehrbüchern; sie ist (vielmehr) eine Aufforderung zu ihrer Verbesserung. Dass Popularisierungen unvermeidlich eine Verfälschung seien, das scheint mir nicht mehr als ein Akademiker-Vorurteil zu sein.
Wann ein Studium des Marx’schen Originals angebracht wäre
Voraussetzung für das Verfassen eines Lehrbuchs ist das Vorliegen einer (mehr oder weniger) entfalteten Theorie, zumindest eines Theorie-Konzepts (oder wie es inzwischen gern heißt: eines Paradigmas), mit dem sich mit Aussicht auf bedeutsame Ergebnisse arbeiten lässt.
Das gibt es zweifelsfrei etwa bei Newton oder bei Darwin: die (klassische) Physik bzw. die Evolutionsbiologie. Aber bei Marx? Gibt es mehr als bloß das Werk von Marx? Gibt es marxistisches Lehrbuchwissen? Gibt es einen zur systematischen Theorie ausgebauten und modifizierten Marx, also Marxismus? Gibt es, mit anderen Worten, kritische, emanzipatorische Sozialwissenschaft?
- Von Gegnern des Marxismus wird bestritten, dass es eine sachlich vertretbare (eine erfolgreiche, eine bisher haltbare) Theorie, den Marxismus, gibt. Diese Position ist kein großes theoretisches Problem. Schon Thomas Hobbes wusste: Menschen „widersetzen sich der Vernunft, wenn es ihre Interessen erfordern … Wäre der Satz: Die drei Winkel eines Dreiecks sind gleich
den zwei rechten Winkeln eines Quadrats dem Herrschaftsrecht irgendeines Menschen oder den Interessen derer,
die Herrschaft innehaben, zuwidergelaufen, so zweifle
ich nicht daran, daß diese Lehre wenn nicht bestritten, so doch durch Verbrennung aller Lehrbücher der Geometrie unterdrückt worden wäre, soweit die Betroffenen dazu in der Lage gewesen wären.“
- Andere – meist Marx-Anhänger – argumentieren, es gebe nicht den Marxismus, sondern (mehrere) Marxismen. Diese Behauptung ist wenig überzeugend. So viele Gruppierungen mit voneinander abweichenden Marxismus-Versionen es auch gibt, so ist doch kaum ernsthaft zu bestreiten, dass all diese Versionen Gemeinsamkeiten aufweisen, die den Begriff der Marxismus (im Singular) sinnvoll erscheinen lassen. (Kein Mensch bestreitet etwa, dass das Christentum aus verschiedenen Konfessionen und unzähligen Sekten mit voneinander abweichenden Glaubenslehren besteht; doch hindert das niemanden, den Begriff das Christentum zu benutzen, um das Gemeinsame, etwa gegenüber anderen Religionen, zu betonen. Dagegen spricht, dass es doch wohl darum geht – jedenfalls gehen sollte –, die marxistische Theorie zu einem möglichst hilfreichen Werkzeug der Emanzipation zu machen. Und dafür ist es belanglos, wieweit sie originaler Marx ist. (Auch wenn es sicherlich ein propagandistischer Vorteil wäre, wenn man erklären könnte und die Anderen zustimmen müssten, die eigene Theorie-Version sei die authentische Marx’sche Theorie. Was aber illusorisch ist. Der Streit um diese Frage dürfte zu keiner Klärung, sondern nur zu endlosen, ergebnislosen Debatten führen.)
- Wieder Andere – ebenfalls meist Marx-Anhänger – erklären, alle Marxisten hätten bisher Marx falsch verstanden. Oder sie kritisieren den bisherigen Marxismus als „Weltanschauung“ oder als „Arbeiterbewegungsmarxismus“. Und der Fortschritt liege gerade in der Auflösung dieses als Weltanschauung oder als Arbeiterbewegungsmarxismus missverstandenen Marxismus, er liege in der Umwandlung vermeintlicher marxistischer Erkenntnisse in – offene – Probleme. So kann man etwa lesen: „Der neuen Marx-Aneignung ist zu verdanken, dass mit Marx keine Weltanschauung mehr möglich ist. Es ist nicht mehr möglich, aus der Kritik der politischen Ökonomie eine wissenschaftliche oder gar revolutionäre Theorie zu machen, im Gegenteil, die Neue Marx-Aneignung hat eher ein Problembewusstsein als einen irgendwie ‚positiven‘, wissenschaftlich gesicherten Bestand geschaffen, und zwar ein Bewusstsein sowohl was die Probleme einer radikalen Kritik des Kapitalismus als auch was dessen bloße Darstellung angeht.“ All diese (behaupteten) „Auflösungen“ sprechen dem Marx’schen Werk ab, heute noch gültige, brauchbare Einsichten gewonnen zu haben. Marx würde damit allenfalls zugestanden, ein großer Denker gewesen zu sein. Das würde bedeuten, dass man ihn nicht mit Newton und Darwin in eine Reihe zu stellen hätte, sondern mit Platon, Descartes oder Kant (oder anderen großen Philosophen). Marx wäre sozusagen zu einem bedeutenden Philosophen degradiert, zu einem Schöpfer einer Weltsicht und -kritik, die eine Zeitlang zwar viele Menschen geteilt haben, die aber keine haltbare Theorie ist. Marx wäre (bloß) Philosoph, den zu lesen, neu zu lesen und neu zu interpretieren vielleicht immer wieder lohnt. Bei einer solchen Betrachtungsweise, die negiert, dass die Marx’sche Theorie der politischen Ökonomie die Grundlegung einer kritischen, emanzipatorischen Sozialwissenschaft, genannt Marxismus, ist, wäre in der Tat die Lektüre der Marx’schen Originaltexte angebracht.
Widerlegen lässt sich so eine „philosophische“ Sicht von Marx’ Werk theoretisch kaum. Nur praktisch: durch die systematische Darlegung der marxistischen kritischen Theorie, so haltbar und so aktuell wie möglich.
Ein anderer Grund für ein Studium des Marx’schen Originalwerks wäre, wenn Das Kapital ohne Folgen geblieben wäre, wenn es nicht zur systematischen Theorie ausgebaut und modifiziert worden wäre, mit der gearbeitet werden kann und gearbeitet wurde und wird. Wenn es also nur Marx’sche Theoreme gäbe, aber keinen Marxismus. (Genauso wie man die Hauptwerke von Newton und Darwin studieren müsste, wenn es keine auf ihnen aufbauende, sie systematisierende und erweiternde Physik bzw. Evolutionsbiologie gäbe.)
Heinrich u.a. behandeln Marx wie einen Newton ohne auf ihn folgende Physik, wie einen Darwin ohne auf ihn folgende Evolutionsbiologie. Heinrich u.a. zufolge müssen die Leser von Marx’ Hauptwerk die aufs Kapital auf bauende Sozialwissenschaft erst selber liefern – im Anschluss an ihr Studium des Marx’schen Hauptwerks. Eine mehr als herkulische Arbeit, eine kaum von den Lesern zu erbringende Leistung, die da erwartet wird.
Anforderungen an marxistische Lehrbücher
Die Aufgabe von marxistischen Lehrbüchern ist es, eine systematische Darstellung des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes des Marxismus zu geben: die grundlegenden Fragestellungen, die Grundbegriffe, die wesentlichen Ergebnisse (zu denen auch die Verarbeitung der Erfahrungen der Zeit nach Marx und Engels gehört) und schließlich die offenen strittigen Fragen. Also all das, was Marx und Engels und ihre Nachfolger zu einer emanzipatorischen Theorie des Kapitalismus und des Sozialismus beigetragen haben.
Was nicht Aufgabe eines marxistischen Lehrbuchs ist, ist die Darstellung der Gedankenentwicklung der „Klassiker“ Marx und Engels usw. (Genauso wie ein Lehrbuch der Physik oder der Entwicklungsbiologie kein Buch über Newton oder über Darwin ist.) Was marxistische Lehrbücher wie alle Lehrbücher darüber hinaus leisten sollten: Sie sollten klar und allgemeinverständlich geschrieben sein.
1. Zur Kritik dogmatischer Lehrbücher
Die meisten marxistischen Lehrbücher sind dogmatische Lehrbücher. Dogmen sind Aussagen, die als wahr angesehen werden (müssen) und die nicht bezweifelt werden (dürfen). Es ist nicht der Inhalt oder die Form, wodurch sie sich von wissenschaftlichen Theoremen unterscheiden, sondern das Verbot, sie infrage zu stellen.
Geschichtlich einflussreich wurde die Dogmatisie-rung des Marxismus, die von der Führung der UdSSR praktiziert wurde. So erklärte die stalinistische politische Führung z.B.
- Theorien für unbezweifelbar wahr (etwa die Agrar-Theorien von T. D. Lyssenko),
- Strategien bzw. Taktiken für unbezweifelbar richtig (etwa die Bekämpfung der SPD in der Weimarer Republik als „de(n) gemäßigte(n) Flügel des Faschismus“ (Stalin) durch die KPD von 1924 bis 1935),
- Sachverhalte für unbezweifelbar existent bzw. nicht-existent (etwa, dass bestimmte Menschen historisch nicht existieren bzw. nicht existiert haben, dass sie zu Unpersonen gemacht worden sind).
Der Vorgang der Dogmatisierung wird deutlich, wenn Stalin 1931 etwa erfolgreich kritisiert, dass geschichtliche Tatbestände, die er bereits interpretiert hat, weiterhin zur Diskussion gestellt werden. Stalin: Man dürfe nicht ein „Axiom zu einem Problem […] machen, das der ‚weiteren Bearbeitung‘ bedürfe.“ Wohlgemerkt: Es war seine eigene Interpretation, die Stalin hier als ‚Axiom‘ bezeichnete. Und so war es nur noch erlaubt – so formulierte es Wolfgang Harich –, „Kommentare und popularisierende Exegesen dessen zu liefern, was in den Schriften dieses einen Mannes – bzw. in den Werken von Marx, Engels und Lenin – zu lesen steht.“
a) Zur Dogmatisierung des Marxismus als Marxismus-Leninismus
Das Produkt dieser Dogmatisierungen war der Marxismus-Leninismus: eine dem Anspruch nach all(es)umfassende Theorie, die beanspruchte, im Besitz der Wahrheit zu sein. Und für Jeden im Machtbereich des Marxismus-Leninismus waren dessen Dogmen verbindlich.
Das entscheidende Strukturmerkmal dieses Marxismus-Leninismus war, dass die jeweilige Führung die Instanz war, die autoritativ festlegte, was der Fall ist und was nicht. Sie hatte das Deutungsmonopol. Sie – und nur sie – hatte das Recht, „den Schatz der ewigen Wahrheiten verbindlich zu interpretieren, durch neue zu vermehren oder eine bis dahin als unwiderleglich geltende Wahrheit außer Verkehr zu setzen.“
Interpretationen, die nicht von der jeweiligen Führung stammten oder nicht von ihr legitimiert wurden, waren „Abweichungen“ von der Wahrheit, waren „Revisionismus“. Und Revisionismus war immer und ausschließlich im Interesse des Klassenfeindes – ein weiteres Dogma.
Solch eine Dogmatisierung des Marxismus zu einem System von unbezweifelbar wahren Grundsätzen, von Axiomen, wurde zwar bestritten – so beendete etwa Stalin eine Diskussion über Sprachwissenschaft mit den Worten: „Der Marxismus ist ein Feind jeglichen Dogmatismus.“ Doch solche Beteuerungen zeigten nur, wie Henri Lefèbvre formulierte, das Bestehen eines „Ultradogmatismus“, „der imstande ist, seinen eigenen Dogmatismus zu leugnen, um ihn besser durchsetzen zu können, indem er rituelle ‚Diskussionen‘ ohne wirkliche Tragweite organisiert. In dem Maße, wie die aufgeworfenen Probleme real sind, gestattet die ‚Diskussion‘ nur eine im voraus festgelegte und präfabrizierte Lösung.“ Stalin „spottete über jene, die ihn in jeder Zeile zitieren, während man ihn in jeder Zeile zitieren mußte, um auch nur den bescheidensten Artikel veröffentlichen zu können.“
Das Dogma, das nicht bezweifelt werden durfte,
war übrigens nicht die Gesamtheit der Texte von Marx usw. Auch wenn die stalinistische Führung offiziell den gesamten Marx für „die Wahrheit“ erklärte, so wählte sie faktisch durchaus au S. So ist z.B. Marx’ Geschichte der Geheimdiplomatie des 18. Jahrhunderts. Über den asiatischen Ursprung der russischen Despotie, geschrieben 1856/57, in der mehr als 40-bändigen Marx-Engels-Werke-Ausgabe, der MEW, nicht enthalten. Und z. B. Lenins Brief an den Parteitag (vom Dezember 1922) wurde in der Sowjetunion erstmals 1956 veröffentlicht41. Und wie die zum Dogma erklärten Texte zu interpretieren waren, auch das legte die Führung fest.
Dadurch, dass die politische Führung sich zur letzten Instanz und zum Schiedsrichter in allen Fragen machte, sorgte sie dafür, dass keines ihrer Dogmen für ihre eigene Politik zum Hindernis werden konnte; durch ‚schöpferische Weiterentwicklung‘ konnte sie dem Marxismus-Leninismus jeweils den Inhalt geben, den sie für politisch erforderlich hielt.
b) Ein Beispiel eines dogmatischen Lehrbuchs
1974 erschien das Lehrbuch Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus: Lehrbuch für das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium. Es erschien 1988 in einer „vollständig überarbeiteten Auflage“; die letzte, die 15. Auflage erschien 1989. In dieser 15. Auflage heißt es im letzten Kapitel, das die Überschrift hat: „Perspektiven des ökonomischen Wettstreits zwischen Sozialismus und Kapitalismus“:
„Der Sozialismus existiert als objektive Realität vor allem in Gestalt der sozialistischen Staatengemeinschaft, deren weltweiter Einfluß durch die Erschließung und umfassende volkswirtschaftliche Nutzung von qualitativen Wachstumsfaktoren weiter zunehmen wird. Der Sozialismus hat in diesen Ländern ein für allemal gesiegt… Die weitere Freilegung der dem Sozialismus immanenten sozialen Triebkräfte für die ökonomische Entwicklung gibt die Gewähr für den endgültigen und vollständigen Sieg des Sozialismus im ökonomischen Wettstreit mit dem Kapitalismus.“ usw. Vier Seiten später endet dies Lehrbuch mit einem Zitat aus einer Parteitagsrede von Erich Honecker.
Hier zeigt sich klassisch, zu welcher Realitätsblindheit parteihörige Dogmengläubigkeit von Forschern führen kann.
2. Nicht-dogmatische marxistische Lehrbücher
Es gibt, soweit ich sehe, nur wenige nicht-dogmatische marxistische Lehrbücher der marxistischen politischen Ökonomie. Dazu gehören
- der von Iring Fetscher herausgegebene Band Grundbegriffe des Marxismus. Eine lexikalische Einführung,
- Harald Grzegorzewski Die marxistische Wirtschafts- und Staatstheorie. Eine umfassende Gesamtdarstellung auf dem Hintergrund der Entwicklung und der Realität des Kapitalismus in Deutschland,
- das fünfbändige Werk von Stephan Krüger: Kritik der Politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse
- und die drei Werke von Ernest Mandel: Marxistische Wirtschaftstheorie und: Einführung in die marxistische Wirtschaftstheorie und: Einführung in den Marxismus
Die genannten marxistischen Lehrbücher haben verschiedene Mängel. So sind Fetscher und Grzegorzewski thematisch etwas beschränkt: Bei Fetscher findet sich nichts über die Wirtschaftsordnung der Sowjetunion. Grzegorzewskis Analyse ist begrenzt auf die Analyse der BRD. Krügers Kritik der Politischen Ökonomie und Kapitalismusanalyse ist zwar ein aktuelles marxistisches Lehrbuch der politischen Ökonomie, aber es ist schwierig zu lesen und verlangt umfangreiche Vorkenntnisse. Mandels Marxistische Wirtschaftstheorie hingegen ist thematisch umfassend und ist verständlich geschrieben. Allerdings ist es vor inzwischen 50 Jahren (1968) erschienen.
a) Ernest Mandel Marxistische Wirtschaftstheorie
– ein geeignetes Lehrbuch der marxistischen politischen Ökonomie?
In der 1960 geschriebenen Einführung zur Marxistischen Wirtschaftstheorie kritisiert Mandel die Marx-Anhänger: „Seit beinahe 50 Jahren begnügen sie sich damit, die Lehre von Marx in Zusammenfassungen des Kapitals zu wiederholen, die mehr und mehr den Kontakt mit der heutigen Wirklichkeit verlieren.“ Nach Mandels Ansicht sind „Ausführungen, die sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts damit begnügen, mehr oder weniger getreue Zusammenfassungen des im vergangenen Jahrhundert geschriebenen Kapitals zu geben, gerade vom marxistischen Standpunkt aus völlig unzureichend“.
Mandel unternahm deshalb mit seinem Buch den Versuch, „für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zu leisten, was Marx für das 19. geleistet hat“, also nicht eine Darstellung der Marx’schen Theorie, die (unvermeidlich) an der Wirtschaft und Gesellschaft des 19. Jahrhunderts orientiert ist, sondern eine systematische Analyse, die hauptsächlich den Kapitalismus des 20. Jahrhunderts sowie die Sowjetunion und die anderen nicht-kapitalistischen Gesellschaften zum Inhalt hat – also eine systematische Analyse der (damaligen) Gegenwart, auf Marx fußend, doch über ihn hinausgehend: ihn ausbauend, erweiternd, systematisierend, kurz: eine marxistische Analyse.
Hierbei verzichtete Mandel auf das übliche Zitieren der ‚Klassiker‘: „Dem Leser, der nach vielen Zitaten von Marx und Engels oder ihren bedeutendsten Schülern sucht, sei … eine Warnung erteilt. Er wird dieses Buch enttäuscht wieder schließen. Im Gegensatz zu allen anderen Autoren marxistischer ökonomischer Schriften haben wir uns – mit wenigen Ausnahmen – strikt enthalten, ‚heilige‘ Texte zu zitieren oder auszulegen. Wir stützen uns vielmehr auf die namhaftesten Wirtschaftstheoretiker, Wirtschaftshistoriker, Ethnologen, Anthropologen, Soziologen und Psychologen unseres Zeitalters, soweit sie Erscheinungen der wirtschaftlichen Aktivität menschlicher Gesellschaft in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft beurteilen.“
Mandel sah in seiner Marxistischen Wirtschaftstheorie nicht mehr als einen ersten, verbesserungsbedürftigen Versuch: „Wir haben weder die sprachlichen Fähigkeiten noch die nötigen historischen Kenntnisse, um ein solches Unterfangen erfolgreich beenden zu können. Aber es ist deswegen nicht weniger dringend. … Unsere Arbeit bleibt daher ein Versuch, ein Entwurf, der auf zahlreiche Berichtigungen gefaßt ist.“
Mandel verstand seinen verbesserungsbedürftigen Versuch von 1962 sehr optimistisch als „eine Aufforderung an die junge marxistische Generation in Tokio und Lima, in London und Bombay und – warum nicht – in Moskau, New York, Peking und Paris … durch gemeinsame Arbeit das zu vollbringen, was durch individuelle Arbeit offensichtlich nicht vollbracht werden kann.“
b) Rezensionen zu Mandels Lehrbuch-Versuch
Wie wurde dieser Versuch einer systematischen und aktuellen Darstellung der marxistischen Wirtschaftstheorie bei ihrem Erscheinen aufgenommen? Zu Mandels Marxistischer Wirtschaftstheorie liegen drei deutschsprachige Rezensionen vor, deren Kritik hilfreich ist zur Beantwortung der Frage: Ist Mandels Buch ein verbesserungswürdiger oder ein grundsätzlich verfehlter Versuch eines Lehrbuchs der marxistischen Wirtschaftstheorie? (Dass er als ein erster Versuch unvermeidlich mehr oder minder fehlerhaft und also verbesserungsbedürftig sein dürfte, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein.)
1. Wolfgang Müller Marxistische Wirtschaftstheorie und Fetischcharakter der Ware. Kritische Bemerkungen zum Hauptwerk Ernest Mandels
Müller nennt Mandels Werk ein „imposantes Werk“ und lobt dessen „umfassenden inhaltlichen Reichtum“. Müller erklärt weiter, dass Mandel neue historische Tatsachen, die Marx nicht bekannt waren, für seine Darstellung nutzt, und fährt dann fort:
Es „muß das grundsätzlich andere Verfahren auffallen, das Marx … angewendet hat. … In der literargeschichtlich vorliegenden Selbstverständigung der bürgerlichen Gesellschaft, der politischen Ökonomie seit dem 17. Jahrhundert, näherte sich Marx seinem ‚Stoff‘, den er nach der Aneignung im Detail in der komplementären Einheit von dialektisch-logischer und historischer Ableitung ‚darstellte‘. … Erst beide Darstellungsformen zusammen ergeben die vollständige dialektisch-materialistische Analyse. Mandel dagegen beschreibt bloß die ‚historische Genesis‘.“ Trotz dieser Kritik bezweifelt Müller nicht, dass Mandels Werk die Eignung zu einem Lehrbuch hat – nach einigen die Argumentation vertiefenden Verbesserungen.
2. Autorenkollektiv „Marxistische Wirtschaftstheorie“ – ein Lehrbuch der Politischen Ökonomie?
Auch diese Autoren stellen bei Mandel „eine Differenz zur Marx’schen Vorgehensweise“ fest. Und diesen Unterschied kritisieren sie: Damit gehe „Mandel im Gegensatz zu Marx“ vor. Im Unterschied zu Müller ist das Ergebnis dieser Rezensenten negativ: „Mandels ‚Marxistische Wirtschaftstheorie‘ ist als Lehrbuch der politischen Ökonomie nicht geeignet“.
3. Karl-Heinz Roth Ernest Mandel – ein Vertreter der zeitgenössischen Kritik der politischen Ökonomie
Roth zufolge ist in Mandels Buch „(d)ie Methode der Kritik der politischen Ökonomie im Sammelsurium ‚heutiger Wissenschaften‘ untergegangen, statt daß sich Mandel die Informationsmassen der heutigen Wissenschaften aneignete, um auf dieser breiten stofflichen Grundlage mittels der Methode die Kritik der politischen Ökonomie, die marxistische Wirtschaftstheorie(,) voranzutreiben.“
Ein Beispiel dafür, was Mandel laut Roth nicht leistet, übersieht bzw. falsch macht: „Er ist nicht fähig, die jeweiligen historischen Wertformen, die innerhalb des Tauschaktes entstehen, auf den Begriff zu bringen. Ihm bleibt somit verborgen, wie der Gebrauchswert – und damit auch das ‚gesellschaftliche Mehrprodukt‘ als Bestandteil des Gebrauchswerts – überhaupt zur Erscheinungsform seines Gegenteils, des Werts, zu werden vermag. Folglich kann er auch nicht die sich zur allgemeinen Warenproduktion schrittweise entwickelnde Produktionsweise als in sich widersprüchlichen und historisch entfaltenden Prozeß erfassen. Der Versuch, diesen inneren widersprüchlichen Prozeß historisch herzuleiten, scheitert, weil Mandel der hierzu sehr wohl erforderlichen Methode der Kritik der politischen Ökonomie nicht mächtig ist.“ „So scheitert Mandel notwendigerweise auch bei der Analyse des gegenwärtigen Kapitalismus.“
Für Roth ist Mandels Marxistische Wirtschaftstheorieein völlig verfehltes Buch. Ihm ist unerklärlich, warum Mandel „sich bis heute nicht von seiner ‚Marxistischen Wirtschaftstheorie‘ losgesagt“ hat.
c) Zur Analyse der Rezensionen
1. Der Kritik-Maßstab der Rezensenten
Der Maßstab der Kritik, die die Rezensenten üben, ist
die Marx’sche Vorgehensweise, wie sie sie verstehen. Die Rezensenten behandeln ihre Interpretation von Marx wie ein Dogma: Wer die Marx’sche Theorie nicht genauso versteht wie sie, der verfehlt unvermeidlich nicht nur die Marx’sche Theorie, sondern auch die Wahrheit. Sie halten das Vorgehen von Marx für alternativlos, als allein der Sache angemessen. Jede Abweichung davon wird als Irrweg kritisiert. Sie unterlassen es zu prüfen, ob Einsichten, die Marx hatte und die bei Mandel (angeblich) fehlen, nicht auch mit Mandels Vorgehensweise erlangbar sein können und ob gelegentliche Abweichungen von Marx vielleicht gut begründet und damit gut marxistisch sind.
Zwar dürfte kaum stimmen, was Paul Feyerabend provokativ behauptete: Anything goes (Mach, was du willst). Sicherlich führen nicht alle Wege nach Rom; vielleicht aber doch mehr als nur einer?
2. Negative Bewertung alternativer Vorgehensweisen
Die von den Rezensenten festgestellte „Differenz zur Marx’schen Vorgehensweise“ bedeutet für sie, dass Mandel sich „im Gegensatz zu Marx“ befindet. Die Mandel’sche „Differenz zur Marx’schen Vorgehensweise“, beweise Mandels „Unfähigkeit“73 zu marxistischer Theorie-Produktion. Die Abweichungen Mandels von Marx’ Vorgehensweise und Begrifflichkeit würden dazu führen, dass Mandel nicht erkenne und nicht erkennen könne, was Marx erkennen konnte und erkannte.
Hier drei Beispiele für von den Rezensenten gerügte Abweichungen Mandels von Marx:
- Müller merkt zum Begriff „Wertgesetz“ bei Mandel kritisch an: „Gerade bei diesem Begriff ist die terminologische Festlegung bei Marx selbst nicht festzustellen (wenn er überhaupt von Gesetz spricht, so vom Gesetz der Ware(n), des Wertes, des Warenaustauschs, dem Arbeitswertgesetz usw.); darin ist angedeutet, daß sein Interesse nicht so sehr den quantitativen Beziehungen, der Größe des Werts, als seiner besonderen Form gilt.“ Mir scheint: Nach dieser Logik dürfte man bei Marx und Engels nicht von einer Analyse des Kapitalismus sprechen. Denn der Begriff „Kapitalismus“ kommt in ihrem umfangreichen Werk (laut den Sachregistern der Kapital-Bände der MEW) nicht vor. Nur einmal benutzt Marx demnach überhaupt den Begriff „Kapitalismus“, und zwar in einem Interview in der Tribune vom 18. Dezember 187875.
- Das Autorenkollektiv wirft Mandel zentral vor, dass er Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftstheorie identifiziere, und sie belegen ihre Kritik folgendermaßen: „…versucht Mandel einen Überblick sowohl über die universelle Wirtschaftsgeschichte als auch über die marxistische Wirtschaftstheorie zu geben, d.h. beide Aufgaben sind ihm eine, denn nach seiner Auffassung ist es gerade die ‚dynamische Verbindung von Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftstheorie‘, auf der ‚die große Überlegenheit der Marxschen Methode im Vergleich mit anderen ökonomischen Schulen beruht‘.“ Nun ist eine „dynamische Verbindung“ zweifellos etwas anderes als eine „unmittelbare Identität“, und so ist diese Kritik: „d. h. beide Aufgaben sind ihm eine“ schlicht unzutreffend.
- Roth kritisiert u. a., dass für Mandel die Produktionsweise der Sowjetunion keine kapitalistische Produktionsweise ist: „Mandel übersieht, daß seine ‚nichtkapitalistische Produktionsweise‘ eine Produktionsweise ist, die bis heute auf staatlicher Aneignung und Planung des gesellschaftlichen Gesamtproduktionsprozesses beruht.“ Diese Kritik von Roth legt die Frage nahe, was Roth unter „Kapitalismus“ versteht. An dieser Stelle jedenfalls offenkundig nichts, was dem Marxschen Kapitalismus-Begriff auch nur entfernt ähnlich ist. Denn für Marx und Engels ist eine Wirtschaft, die „auf staatlicher Aneignung und Planung des gesellschaftlichen Gesamtproduktionsprozesses beruht“, zweifellos keine kapitalistische Wirtschaft, für die bekanntlich die Abwesenheit von gesamtwirtschaftlicher Planung charakteristisch ist.
3. Können Abweichungen von Marx (gut) marxistisch sein?
Haben aber die Mandel-Kritiker nicht insoweit Recht, als Abweichungen von Marx, selbst wenn sie sachlich gerechtfertigt sein sollten, ein Beweis dafür sind, dass es sich um kein marxistisches Werk handelt? Um als marxistisch charakterisiert werden zu können, muss eine Theorie sicherlich die wesentlichen Einsichten von Marx und seine emanzipatorischen Ziele, zu deren Verwirklichung seine Theorie-Arbeit eine Hilfe sein soll, bewahren. Das kann aber nicht heißen, dass eine marxistische Theorie jedes einzelne Marx’sche Theorem, jede einzelne Vorgehensweise, jedes Ergebnis und jede Hypothese von Marx übernehmen müsste – im Gegenteil: Marxistische Theorie ist der systematische Ausbau, die Erweiterung der Marx’schen Theoreme – bei Beibehaltung der emanzipatorischen Intentionen. Aber welche Abweichungen sind marxistisch zulässig?
- Die Revision von Ergebnissen scheint mir zulässig bzw. geboten, wenn diese sich nach aktuellem Wissensstand als unhaltbar herausstellen.
- Die Revision von Methoden, mit denen Marx zu seinen Ergebnissen gelangt ist, sollte man ebenfalls nicht prinzipiell für unzulässig halten. Denn es ist, wie gesagt, nicht auszuschließen, dass mehr als nur ein Weg nach Rom führt. Und vielleicht gibt es sogar kürzere oder bequemere Wege als die von Marx gewählten. Dieser banalen Erkenntnis scheinen sich allerdings die meisten (heutigen) Marxisten zu verschließen, da sie die Marx’schen Methoden für die allein zum Ziel führenden Methoden halten – ungeachtet der Tatsache, dass bis heute keine Klarheit und Einigkeit darüber erzielt werden konnte, wie Marx denn tatsächlich vorgegangen ist. Ohne diese tatsächliche Unklarheit wäre das Entstehen einer Neuen Marx-Lektüre völlig unverständlich, die über 100 Jahre nach Marx und Engels endlich herausfinden will, was Marx denn tatsächlich herausgefunden hat und wie er dabei vorgegangen ist – was alle Marxisten bis dahin nicht verstanden hätten.
- Was schließlich die Revision von Begründungen der von Marx praktizierten Vorgehensweisen betrifft, ist zu bedenken, dass diese Begründungen zeitgebunden sein könnten und geleitet von zeitverhafteten Argumenten für bzw. gegen Zeitgenossen – vor dem Hintergrund der damaligen Philosophie (Hegel usw.) und der damaligen Wissenschaftsphilosophie (der klassischen politischen Ökonomie). D.h.: Auch die Marx’schen Begründungen sollten revidierbar sein.
Schluss
Was wäre vermutlich passiert, wenn man seinerzeit mit Newton und Darwin so umgegangen wäre, wie man mit Marx umgeht? Irgendwann hätten die Newton- bzw. die Darwin-Leser vermutlich herausgefunden, dass z. B. die beiden Wissenschaftler jeweils in die zweite Auflage ihres Hauptwerks Gott eingeführt haben. Das hätte ihnen klar und eindeutig gezeigt, dass das Hauptwerk von Newton für die Physiker und das Hauptwerk von Darwin für die Evolutionsbiologen bis heute „ein Buch mit sieben Siegeln geblieben ist“. Und das hätte die Newton- und die Darwin-Leser sicherlich zu weitreichenden und tiefsinnigen Untersuchungen genötigt – zu einer Neuen-Newton-Lektüre bzw. zu einer Neuen-Darwin-Lektüre. Mit dem Ziel, Newton bzw. Darwin erstmals richtig – authentisch – zu interpretieren. Allerdings: Die Physik und die Evolutionsbiologie gäbe es dann bis heute vermutlich nicht.
Die Wirkungsgeschichte von Newton ist bekanntlich die (klassische) Physik, die Wirkungsgeschichte von Darwin die (evolutionstheoretische) Biologie. Und die Wirkungsgeschichte von Marx ist die Marxismus genannte Gesellschaftstheorie. Und so wie heute niemand systematisch Newtons Hauptwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) bzw. Darwins Hauptwerk On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859) studiert, sondern Physik oder Biologie, wenn er sich über die Wirklichkeit orientieren will, so sollte man nicht weiterhin das Marx’sche Hauptwerk Das Kapital (1867) zu verstehen versuchen, sondern den Marxismus studieren, soweit er emanzipatorische Gesellschaftstheorie ist. Und dazu braucht man ein gutes Lehrbuch der Kritik der politischen Ökonomie.
Fussnoten
1 Ich beschränke mich im Folgenden auf die Wiedergabe der Argumente, die Michael Heinrich vorgebracht hat. Ganz ähnliche Argumente finden sich bei Elmar Altvater und Wolfgang Fritz Haug.
2 2., durchgesehene und erweiterte Auflage Stuttgart 2004
3 Ebd., S. 8
4 Heinrich: Wie das Marxsche „Kapital“ lesen? Teil I, S. 20
5 Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung, S.8
6 Heinrich …, Teil I, S. 31
7 Zitiert nach: Joseph Dietzgen: Schriften in drei Bänden. Berlin
1961, Bd. 1, S. 17/8
8 Soweit ich sehe, gibt es solche Lesehilfen auch nicht.
9 Siehe z.B. Ulrich Kutschera in: Charles Darwin: Die Entstehung der Arten. Kommentierte und illustrierte Ausgabe. Hg.: Paul Wrede u. Saskia Wrede. Weinheim 2013, S. VI/VII: „Die wesentlichen Aussagen von Darwin wurden durch die moderne Evolutionsforschung … in vollem Umfang bestätigt. Allerdings sind zahlreiche neue Fakten, Prinzipien und Theorien hinzugekommen, von denen Darwin nichts wissen konnte … Unser stetig wachsendes ‚Theoriensystem Evolutionsbiologie‘ hat sich daher so weit von den ursprünglichen Thesen aus dem 19. Jahrhundert entfernt, dass Charles Darwin heute keine Prüfung im Fachgebiet der Evolutionswissenschaften bestehen könnte.“
10 Heinrich in: Bonefeld/Heinrich 2011, S. 168. Kursivierung nicht bei Heinrich.
11 Heinrich in: Kritik …, S. 10
12 Heinrich in: … Teil I, S. 18
13 Heinrich in: … Teil I, S. 17
14 Heinrich in: … Teil I, S. 18/19
15 Als „Lehrbücher“ betrachte ich auch all die „Einführungen“, die beanspruchen, den jeweils aktuellen Wissensstand darzustellen und die Lektüre des Originals unnötig zu machen. Ein Beispiel dafür ist etwa Ernest Mandels Einführung in den Marxismus (8. Auflage 2008), die zweifellos ein Lehrbuch des Marxismus ist.
16 Heinrich … Teil I, S. 19
17 – Marx: Lohnarbeit und Kapital (1847 im Brüsseler Deutschen Arbeiterverein gehaltene Vorträge, 1849 niedergeschrieben), mit einer Einleitung von Engels (1891)
– Engels: Grundsätze des Kommunismus (1847)
– Marx und Engels: Manifest der kommunistischen Partei (1848), in dem Marx und Engels kurz und umfassend die „Anschauungsweise, Zwecke und Tendenzen der Kommunisten“ (MEWBd. 4, S. 461) darlegen.
– Marx: Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses (um 1863/64 geschrieben, 1933 erstmals veröffentlicht), eine Zusammenfassung des ersten Bands des Kapital durch Marx selbst
– Marx: Lohn, Preis und Profit (1865 geschrieben; 1898 erstmals veröffentlicht)
– Engels: Anti-Dühring (1876 bis 1878 geschrieben, 1878 erste Buchveröffentlichung), das Kapitel 10 des zweiten Abschnitts über Politische Ökonomie stammt von Marx
– Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft (1880), mit einer „Vorbemerkung“ von Marx, in der
er diese Broschüre als „Einführung in den wissenschaftlichen Sozialismus“ (MEW Bd. 19, S. 185) bezeichnet.
18 Heinrich … Teil I, S. 22/23
19 MEW Bd. 6, S. 397-423
20 Engels rechtfertigte seine Textänderung ausführlich in seiner Einleitung zu der Marx’schen Schrift. Siehe MEW Bd. 6, S. 593-599.
21 MEW Bd. 31, S. 123
22 MEW Bd. 31, S. 125
23 Siehe hierzu meinen Aufsatz: Was spricht eigentlich gegen eine Popularisierung der Marxschen Werttheorie?. In: Karl Reitter (Hg.): Karl Marx. Philosoph der Befreiung oder Theoretiker des Kapitals? Zur Kritik der „Neuen Marx-Lektüre“, Wien 2015,
S. 234-250, sowie meinen Aufsatz: Die Neue Marx-Lektüre – Anspruch und Wirklichkeit. In: Z. Zeitschrift marxistische Erneuerung Nr. 111, 2017
24 Heinrich zeigt übrigens von keinem Lehrbuch, dass es vereinfache, verkürze, unvollständig bzw. selektiv sei. Seiner Lehrbuch-Kritik liegt keine Untersuchung auch nur eines einzigen Lehrbuchs zugrunde.
25 In: Leviathan, Neuwied 1966, S. 79/80
26 Siehe z.B. Heinrich, der als eines seiner Ziele seiner Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie nennt: Es „sollte deutlich werden, dass es ‚den‘ Marxismus gar nicht gibt.“ ( S. 9)
27 So die Neue Marx-Lektüre; siehe z.B. Ingo Elbe: Marx im Westen. Die neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965, Berlin, zuerst 2008
28 So z. B. Michael Heinrich. Siehe etwa in seiner Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung S. 23
29 So z.B. Robert Kurz. Siehe etwa in seinem Marx lesen. Die wichtigsten Texte von Karl Marx für das 21. Jahrhundert. 2000. S.7
30 Frank Engster in: Frank Engster und Jan Hoff: Die Neue Marx-Lektüre im internationalen Kontext. Philosophische Gespräche 28. Helle Panke e.V. Berlin 2012, S. 38
31 Siehe z. B. George Sorel: Die Auflösung des MarxismuS. (1978) Erstmals 1908 erschienen.
32 F.O. Wolf: Das Kapital neu lesen. In: Widerspruch. Heft 62, Zürich 2013, S. 155-164, S. 159
33 Stalin: Werke, Band 6, S. 253
34 Dazu gibt es einen umfangreichen Bildband von David King, der in der neuesten deutschen Fassung den Titel hat:Die Kommissare verschwinden: die Fälschung von Fotografien und Kunstwerken in Stalins Sowjetunion. Berlin 2015
35 Stalin: Fragen des Leninismus, 1970, S. 426
36 Wolfgang Harich: Hemmnisse des schöpferischen MarxismuS. in: Sonntag, 15. April 1956, S. 4, zitiert nach: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 54 (2006), Heft 5, S. 752
37 Lukács: Schriften zur Ideologie und Politik. 1967, S. 654
38 Stalin: Marxismus und Fragen der Sprachwissenschaft, 1968, S. 66
39 Henri Lefèbvre: Probleme des Marxismus, heute, 1965, S. 35
40 Ebd., S. 31
41 Lenin: Werke Bd. 36, S. 577ff.
42 Herausgeber: Horst Richter, zusammen mit 7 weiteren Herausgebern und 17 Autoren
43 Ebd., S. 902/3
44 Hamburg 1976
45 Frankfurt/Main 1988
46 Band 1: Allgemeine Theorie der Kapitalakkumulation …, 2010, 1021 Seiten; Band 2: Politische Ökonomie des Geldes …, 2012, 616 Seiten; Band 3: Wirtschaftspolitik und Sozialismus …, 2016, 567 Seiten; Band 4: Keynes und Marx …, 2012, 416 Seiten; Band 5: Soziale Ungleichheit …, 2017, 708 Seiten.
47 Frankfurt/Main 1968; Neuauflage 2007 im isp-Verlag
48 Frankfurt/Main, auf Deutsch zuerst 1967; die französische Originalausgabe erschien 1964 in Paris
49 Frankfurt/Main. Auf Deutsch zuerst 1973, 2008 in der 8. Auflage; auf Französisch zuerst Brüssel 1975
50 Michael Heinrichs Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung (zweite erweiterte Auflage Stuttgart 2004) gehört nicht zu dieser Gruppe, da diese Einführung nur eine interpretierende Lesehilfe für die drei Bände des Marx’schen Kapital und keine systematische Darstellung der Kritik der politischen Ökonomie ist. Heinrich ebd. S. 9: „Trotz all(er) … Schwierigkeiten sollte man die Lektüre des ‚Kapital‘ auf sich nehmen. Die folgende Einführung kann diese Lektüre nicht ersetzen; sie soll lediglich eine erste Orientierung bieten.“ Und: In dieser Einführung geht es – so Heinrich – „nur um den groben Zusammenhang der Marx’schen Argumentation, allerdings unter Berücksichtigung von allen drei Bänden des ‚Kapital‘.“ Über die drei Bände hinaus geht sie nur mit den beiden Schlusskapiteln zum Thema: „Staat und Kapital“ und: „Kommunismus – Gesellschaft jenseits von Ware, Geld und Staat“. Insoweit ist der Titel der amerikanischen Ausgabe zutreffender: Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital New York. 2012
51 Es erschien erstmals 1962 auf Französisch.
52 Mandel: Marxistische Wirtschaftstheorie …, S. 14
53 Ebd., S. 15
54 Ebd., S. 14
55 Ebd., S. 16
56 Ebd., S. 20
57 Ich stelle die drei Rezensionen im Folgenden nicht detailliert dar, sondern beschränke mich, weil für meinen Zweck ausreichend, auf eine knappe Darstellung, die nur den jeweils wesentlichen Kritikpunkt der drei Rezensionen darstellt.
58 In: Neue Kritik – Zeitschrift für sozialistische Theorie und Politik. Nr. 51/52, Februar 1969, S. 69-86
59 Ebd., S. 70
60 Ebd., S. 85
61 Ebd., S. 76/77
62 Das Autorenkollektiv bestand aus: Veit-Michael Bader, Joachim Bischoff, Heiner Ganssmann, Werner Goldschmidt, Burkhard Hoffmann, Lothar Riehn.
63 In: Das Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften. Nr. 57, 1971, S. 217-227
64 Ebd., S. 217
65 Ebd., S. 219
66 Ebd., S. 227
67 In: Proletarische Front. Gruppe westdeutscher Kommunisten. 1. Jahrgang. Nr. 2/3, Juli 1971, S. 55-72.
68 Ebd., S. 58
69 Ebd., S. 61
70 Ebd., S. 67
71 Ebd., S. 58
72 Paul Feyerabend: Wider den Methodenzwang. Skizzen einer anarchistischen Erkenntnistheorie, 1976, S. 35
73 Z. B. das Autorenkollektiv …, S. 221
74 Müller …, S. 72
75 MEW Bd. 34, S. 512
76 Autorenkollektiv …, S. 216
77Roth…, S.69
78 Siehe zu Newton etwa Voltaire: Elemente der Philosophie Newtons (1741), das Kapitel 1 des ersten Teils: Über Gott. Berlin 1997, S. 91-95.
Und siehe zu Darwin etwa Ulrich Kutschera, S. VII in: Charles Darwin: Die Entstehung der Arten. Kommentierte und illustrierte Ausgabe. Hg.: Paul Wrede u. Saskia Wrede. Weinheim 2013.
79 So Ingo Elbe über das Kapital-Verständnis der Marxisten. In: Elbe: Marx im Westen …, zweite Auflage 2010, S. 283
<sup></sup>