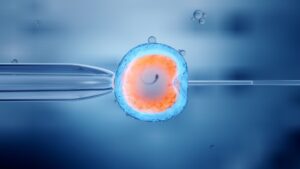In den letzten Monaten wurden vermehrt Diskussionen über die Zukunft und die Strategie der Klimabewegung in der Schweiz geführt. Kürzlich meldete sich auch die Organisation „der funke“ mit der rhetorischen Frage: „Ziviler Ungehorsam oder sozialistisches Programm?“ zu Wort. Im funke-Artikel, der eine „neue“ Strategie für die Klimabewegung vorschlägt, wird ein Gegensatz aufgemacht: Entweder orientiere sich die Bewegung an symbolischen Aktionen und sei höchstens ein bisschen ungehorsam, oder aber sie gebe sich ein sozialistisches Programm und konzentriere sich auf die Arbeiter*innenklasse. Diese Gegenüberstellung zeugt nicht nur von geringem historischen Verständnis, sie verunglimpft auch diejenigen, die seit vielen Monaten unermüdlich im Klimastreik im Einsatz sind und daran beteiligt waren, die politische Themensetzung radikal zu verschieben.
von Matthias Kern (BFS Zürich)
Ein Blick zurück
Die Schweiz am Ende der 1950er Jahre. Die politische Linke ist damals in einer sehr defensiven Position. Nach den Aufständen in Ungarn 1956 und der nur halbherzigen Distanzierung der Partei der Arbeit (PdA) vom Vorgehen Moskaus, das mit der Roten Armee in Ungarn einmarschiert ist, brach die Partei fast vollständig zusammen. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz hatte sich zudem seit der Landesverteidigung im Zweiten Weltkrieg zu einer staatstragenden Partei entwickelt und war an der Regierung auf Bundes- und vielerorts auch auf Kantonsebene beteiligt. Ihr Abschied vom Klassenkampf und von der Konfrontation wurde mit dem neuen Parteiprogramm von 1959 definitiv in die Grundsätze der Partei übernommen. Von nun an wurde nicht mehr der Sozialismus angestrebt, sondern eine soziale Marktwirtschaft, die auf Konkordanz und Arbeitsfrieden basieren sollte. Das bedeutete eine SPS, die grösstenteils im antikommunistischen und bürgerlichen Konsens aufging.
Neben PdA und SPS existierte nicht mehr viel. Das gesellschaftliche Klima, der grassierende Antikommunismus und die als geistige Landesverteidigung bezeichnete Enge in dem, was überhaupt legal als politische Forderung formuliert werden konnte, liess links der SPS nicht viel gedeihen. Zwar gab es innerhalb der SPS einen linken Flügel, allerdings ebenfalls einen äusserst starken und gut vernetzten rechten Parteiflügel, dem zudem viele im Parteiapparat wichtige Personen angehörten.
Als sich im Verlaufe der 1950er Jahre die Idee von ultrarechten militärischen Fanatiker*innen und bürgerlichen Antikommunist*innen, dass die Schweizer Armee mit Atombomben auszustatten sei, zu konkretisieren begann, geschah als Reaktion darauf: nichts. Als dann der Bundesrat 1957 eine sehr konkrete „Absichtserklärung“ abgab, in der er vermeldete, dass man verschiedene Optionen zur Beschaffung von Atombomben für die Schweiz prüfe, geschah ebenfalls praktisch nichts. Trotz globaler Aufrüstungsspirale und trotz dem Wissen um die verheerenden Folgen eines Atomkriegs kam von links viel zu lange keine Reaktion. Der rechte Flügel der SPS konnte sich gleichzeitig gut vorstellen, dass die Schweiz Atombomben besässe und auch alle anderen Parteien (ausser die extrem geschwächte PdA) befürworteten die Bombe.
Ab 1958 organisierte sich der Widerstand dann doch noch: Die Schweizerische Bewegung gegen atomare Aufrüstung (SBgaA) wurde gegründet. Darin federführend waren einige Trotzkist*innen zusammen mit linken Exponent*innen der SPS, dazu Kunstschaffende, Nonkonformist*innen und religiöse Pazifist*innen. Aber keine Partei unterstützte die Bewegung offen, keine Gewerkschaft forderte die eigenen Mitglieder zur Teilnahme auf. Natürlich wurde hinter vorgehaltener Hand in der Sozialdemokratie teilweise schon für das enorm wichtige Vorhaben geworben und gerade auch vom linken Gewerkschaftsflügel kam immer wieder Unterstützung und einige SPS-Sektionen stellten sich nach und nach offen gegen ihre Mutterpartei. Aber dennoch war die SBgaA keine Parteibewegung und auch keine Bewegung, die nur aus Industriearbeiter*innen oder gewerkschaftlich organisierten Personen bestanden hätte.

Stattdessen waren darin die Frauen im Vergleich zu sonstigen politischen Projekten in der Schweiz beinahe schon proportional repräsentiert. Frauen waren auch in linksradikalen Organisationen zu jener Zeit meist nur im einstelligen Prozentbereich vertreten. In der SBgaA machten sie aber einen relevanten Teil der Aktivist*innen aus. Ausserdem war die Jugend stark in der Bewegung vertreten. Nachdem es jahrzehntelang zu keiner nennenswerten Jugendorganisierung gekommen war, interessierte sich nun eine neue Generation in relevantem Masse für ein politisch linkes Thema.
Die SBgaA setzte in ihren politischen Kampagnen gegen die Bombe auf neue Formen der politischen Einflussnahme. Sie startete zwar auch eine Volksinitative (die nicht von der SPS unterstützt wurde), organisierte aber vor allem Ostermärsche, Sit-Ins, Blockaden und Spontandemos. Klassischer ziviler Ungehorsam also. Die symbolischen Aktionen waren wichtig und verhalfen der Bewegung zu Aufmerksamkeit, obwohl sie nur einige tausend Mitglieder hatte.
Ziviler Ungehorsam und die Entwicklung der Linken
Doch wieso ist das überhaupt wichtig? Weil es zeigt wie soziale Bewegungen, die Arbeiter*innenbewegung und die politische Linke als Ganzes zusammenhängen und sich miteinander und im Verhältnis zueinander entwickeln. Und auch weil es zeigt, wie abstrus es ist, verschiedene politische Ausdrucksformen und Kampagnen gegeneinander ausspielen zu wollen.
Die SBgaA war ein Schmelztiegel für die Entstehung einer Neuen Linken in der Schweiz. Eine ähnliche Funktion hatte die zeitgleiche Campaign for Nuclear Disarmament in Grossbritannien. Und in Frankreich nahm ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre die Algerien-Solidarität denselben Charakter an: Während die traditionellen Parteien der Arbeiter*innenbewegung in den Staat eingebunden waren und ihrerseits für die Verbrechen der Aufrüstung oder auch des Krieges in Algerien mitverantwortlich waren, sammelten sich die Teile der Gesellschaft, die damit nicht einverstanden waren, in thematisch angelegten Bewegungen.
In der Schweiz arbeiteten in der Atomjugend, der Jugendbewegung der SBgaA, Jugendliche und junge Erwachsene aus der Sozialistischen Jugend (Jugendorganisation der SPS), aus der Freien Jugend (Jugendorganisation der PdA), aus der Falkenbewegung und viele unorganisierte Jugendliche, zu einem wesentlichen Teil aus den Gymnasien, zusammen. Ihr Protest verstetigte sich, mündete in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre in die ersten grösseren Vietnam-Demonstrationen und diese wiederum in die Umbrüche von 1968. Hier organisierten sich wiederum tausende junger Menschen und forderten grundlegende Umwälzungen. Aus diesen Kreisen heraus entstanden neue linke Organisationen, die selbst wiederum eine Verankerung in den Gewerkschaften anstrebten und die auch die SPS nach links zogen (und zudem auch der PdA zu einem erneuten Aufschwung verhalfen). In Frankreich verbündeten sich 1968 streikende Arbeiter*innen mit den Studierenden und auch hier entstanden langfristig starke linksradikale Organisationen.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die politischen Mittel des zivilen Ungehorsams, in einem modernen Sinne, in der politischen Linken angekommen. Besetzungen, Blockaden, Demonstrationen und Störungen sind nicht Mittel, die einfach neben den „klassischen“ Formen des Streiks oder der parlamentarischen Beteiligung existierten, sondern diese ergänzten und vielen Anliegen überhaupt erst Gehör verschafften. In der Schweiz ist dabei besonders die Besetzung des Bauplatzes des AKW Kaiseraugst 1975 hervorzuheben. In einer einmaligen Zusammenarbeit aus lokalen Initiativen, der entstehenden Ökobewegung, aber auch traditionelleren Organisationen der Arbeiter*innenbewegung gelang es schlussendlich, den Bau eines weiteren AKW in der Schweiz zu verhindern.
Es gäbe hunderte weitere Beispiele des zivilen Ungehorsams aufzuzählen, welche die politische Linke vorwärtsbrachten. Die Geschichte dieser „Aktionsform“, wenn man so möchte, ist reichhaltig und es täte allen Linken gut, sich ab und an mit ihr auseinanderzusetzen, anstatt sie einfach als „unrevolutionär“ abzutun. Die Geschichte von Rosa Parks, die im Bus nicht aufstand, was zu einem Boykott der Busse führte und anschliessend die amerikanische Bürgerrechtsbewegung wesentlich prägte, ist ein gutes Beispiel. Der breite gesellschaftliche Protest und der zivile Ungehorsam war hier auch für die sozialistische Linke in den USA prägend. Oder im arabischen Frühling, als Platzbesetzungen wie diejenige des Tahrir-Platzes inmitten von Kairo zentrales Element der Aufstände waren. Demonstrationen, Streiks, Blockaden und Platzbesetzungen ergänzten sich dabei gegenseitig.
Veränderte Rahmenbedingungen
Dass im Verlaufe der 1960er Jahre auch in der politischen Linken neue Aktionen neben dem klassischen Streik wichtig wurden, hängt stark mit den veränderten Rahmenbedingungen zusammen. Die Arbeiter*innenklasse an sich wurde stärker fragmentiert und spätestens mit den neoliberalen Angriffen ab den 1970er Jahren mehrten sich unkonventionelle Anstellungsverhältnisse, die nicht so einfach zu bestreiken waren.
Dazu kam ein Aufschwung von Arbeitssektoren, in denen Streiks nur erschwert möglich sind. So etwa im Care-Bereich, wo das Leben von Menschen an der regelmässigen Ausführung gewisser Tätigkeiten hängt, die nicht einfach niedergelegt werden können. Gepaart mit der historischen Schwäche und dem Versagen der Gewerkschaften führte das zu einer schwindenden Stärke der Arbeiter*innenbewegung.
Die Ausbildungszeit für die allermeisten Lohnabhängigen wurde verlängert, die Gymnasialquote stark erhöht, die Zahl der Studienabschlüsse ebenfalls. Die soziale Situation und die Bedeutung eines Arbeitsplatzes oder eines einzelnen Unternehmens in einem Lebenslauf hatte vielfach abgenommen. Ebenso war die Möglichkeit und Wirksamkeit von klassischen arbeitsrechtlichen Aktionen wie Warnstreiks, Streiks oder Blockaden von Betrieben ein Stück weit zurückgegangen – auch wenn das natürlich weiterhin zentrale Aktionsformen waren und heute noch sind. Nur werden sie heute meist nur in Fällen, die direkt die Arbeitsstelle betreffen, angewandt. Der politische Streik war in der Schweiz noch nie besonders beliebt und er hat nicht gerade an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren. So oder ähnlich können die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte im Bereich der Arbeiter*innenbewegung in knappster Form skizziert werden.
Natürlich wäre es wichtig, die Einheit der Arbeiter*innen und unsere Schlagkraft wiederherzustellen. Natürlich wäre es schön, wenn wir als politische Bewegung bereits die Macht hätten, Industrie und Wirtschaft stillzulegen und nach den Bedürfnissen der Menschen auszurichten. Doch aktuell fehlen uns die entsprechenden Kräfte. Aber: Es existieren reale Bewegungen und mit der Klimabewegung auch seit langem wieder einmal eine, die gross und bislang beständig ist, und, die die Linke nicht kommen sehen hat.
Schauen wir uns die aktuelle Klimabewegung doch etwas genauer an. Entstanden ist sie aus einer politischen Dringlichkeit. Die Linke – und darin auch die radikale Linke – haben während Jahrzehnten die Thematik des Klimaschutzes und der Ökologie sträflich vernachlässigt. Und von überall sonst sind sinnvolle Lösungsvorschläge, also ein Bruch mit den aktuellen Verhältnissen, nie zu erwarten gewesen.
Der Klimastreik in der Schweiz ist, vielleicht noch mehr als seine Konterparts in Deutschland und einigen anderen Ländern, eine radikale Bewegung. Was der Klimastreik fordert, erreicht eine Dimension und bedeutet eine Umwälzung, wie wir sie in den vergangenen Jahrzehnten in keiner Jugendbewegung in der Schweiz gesehen haben: Nicht in der 1980er Bewegung, die vor allem Freiräume forderte, nicht in den Antikriegsprotesten der frühen Nullerjahre und auch nicht im kurzen Aufflauen der Antiatombewegung rund um Fukushima 2011.

Gleichzeitig kann der Klimastreik mit seinen Forderungen bis auf ein paar NGOs nicht auf etablierten Rückhalt zählen. Was viele als mögliche Schwäche interpretieren, kann eine Chance sein, wenn wirklich tiefgreifende Veränderungen erreicht werden sollen. So können die Inhalte weiterhin mit Konsequenz vertreten werden, ohne in parlamentarische Klüngelspiele hineingezogen zu werden. Dass die Forderungen des Klimastreiks neben der grossen Aufmerksamkeit auch für so viel Ratlosigkeit sorgen, zeigt eben genau auch, dass in den letzten Jahrzehnten nur sehr marginal über Alternativen zum bestehenden, die Umwelt und das Klima zerstörenden System nachgedacht wurde. Die Abwehrreflexe der Bürgerlichen, die mit einem abscheulichen rhetorischen wie teilweise auch rechtlichen Arsenal gegen die vielfach noch minderjährigen Klimaaktivist*innen schiessen, zeigen, dass es um viel geht.
Unsere Mitarbeit in sozialen Bewegungen muss Teil von unserem sozialistischen Programm als kleine Organisationen sein. Ziviler Ungehorsam und seine Bejahung muss ebenfalls ein Teil von unserem Programm sein. Einer Bewegung von aussen sporadisch mitzuteilen, was sie falsch macht und was sie stattdessen machen sollte, sollte hingegen keinesfalls Teil unseres Programms sein. Stattdessen müssen wir ein integraler Teil der Bewegung werden.
Aus der Geschichte in die Gegenwart
In einem Moment, in dem die noch existierenden Organisationen und Parteien der Arbeiter*innenbewegung nicht in der Lage sind, eine angemessene Antwort auf die existenziellen Bedrohungen durch die Klimakatastrophe zu finden, ist ziviler Ungehorsam ein wichtiges Mittel einer Bewegung, die zudem ja nicht ausserhalb der Klasse der Lohnabhängigen stattfindet. Auch Gymnasiast*innen werden zukünftig zum überwiegenden Teil lohnabhängig sein. Und sie werden in vielen Fällen auch in prekären Bereichen arbeiten. Der Gegensatz zwischen Klimabewegung und Arbeiter*innenklasse, der so gerne auch von rechten Kommentator*innen aufgemacht wird (in etwa: Der „kleine Mann“ hat kein Verständnis für die Anliegen der Klima-Schnösel), existiert so schlicht nicht.
Was aber existiert, ist eine erschreckende Untätigkeit der Gewerkschaften und der linken Parteien. Wenn der VPOD es nicht hinkriegt, bei einer Demonstration gegen den Stellenabbau beim Flughafen-Bodenpersonal auch nur ein Wort zum ökologischen Problem der Luftfahrt an sich und den desaströsen Folgen dieser in vielen Dimensionen hirnrissigen Industrie zu verlieren, werden bürokratisierte Organisationen wie der VPOD nicht so schnell die Führung in den ökologischen Kämpfen übernehmen.
Auch die SPS und die Grünen haben nicht einmal ein Jahr nach der angeblichen „Klimawahl“ bereits gezeigt, wie ernst sie es mit unserer Zukunft meinen. Und im Falle der Grünen haben sie sogar ganz fundamentale Zugeständnisse wieder rückgängig gemacht. Netto Null ist im neuen Themenpapier mal auf 2040 angedacht. Und dies, obwohl viele wissenschaftlichen Erkenntnisse darauf hindeuten, dass die Modelle, mit denen in der internationalen Politik bezüglich des Klimawandels gerechnet wird, wohl alle zu optimistisch sind.
Auf die „linken“ Parteien und auch auf die Gewerkschaften können wir uns also nicht verlassen, wenn wir eine lebenswerte Zukunft und die Eindämmung der Klimakatastrophe tatsächlich zum Ziel haben. Wir müssen also Allianzen bilden, auf Organisationen und auf die Reste der Arbeiter*innenbewegung zugehen, während wir grosse Teile der Arbeiter*innenklasse erst noch von unserem Kampf überzeugen müssen. Gleichzeitig und zu diesem Zweck müssen wir aber auch Nadelstiche setzen. Wir müssen zeigen, dass wir da sind. Dass wir konsequent sind. Dass wir ungemütlich werden können. Und dass wir wissen, wo es dem Wirtschaftssystem weh tut und wo wir die politische Kaste verärgern können.
Perspektiven
Was könnte man also anderes machen, anstatt wie der funke doch eher stümperhafte Strategietexte zu verfassen, die so wirken, als hätte man ursprünglich mittelmässige Pamphlete über die Jahre hundert Mal fotokopiert und die wichtigen Teile wären dabei unleserlich geworden, so wie bei Arbeitsblättern in der Schule? Man könnte zum Beispiel in der Bewegung selbst mitwirken und diejenigen Ansätze, die man für besonders sinnvoll erachtet, in besonderem Masse unterstützen, und die anderen zumindest solidarisch begleiten. Es gibt nämlich bereits Ansätze, um die Anliegen des Klimastreiks auch an die Arbeitsplätze der Menschen zu tragen. Es gibt die Versuche, die wichtige Verbindung von ökologischen Kämpfen mit Arbeitskämpfen herzustellen. Beim wegen Corona leider abgesagten Strike for Future (Mai 2020) wäre das genau der Plan gewesen (im Mai 2021 soll es einen neuen Anlauf geben). Dass die Gewerkschaften dabei nur halbherzig mitmachen wollten, heisst noch lange nichts. Ab und an müssen wir diese ein Stück weit vor uns hertreiben, so dass etwas passiert. Und je mehr Menschen das machen, umso besser.
Die engagierten und mutigen Aktivist*innen, die bei Rise Up for Change den Bundesplatz besetzt haben, als politisch fehlgeleitet zu bezeichnen, bringt hingegen niemandem etwas. Die Rise up for Change-Aktion auf dem Bundesplatz war nicht das Ende und auch nicht die entscheidenste Aktion der Klimabewegung. Das dürfte auch den meisten Aktivist*innen bewusst gewesen sein. Aber sie war ein weiterer Schritt in der Herausbildung einer schlagkräftigen, gut organisierten, über die Sprachgrenzen hinauswachsenden ökologischen Bewegung, die noch viele Herausforderungen vor sich hat und noch viele Defizite aufweist, aber auch eine Bewegung ist, die Hoffnung gibt und die politischen Verhältnisse allgemein und in der Linken zu Recht einmal ordentlich durchgeschüttelt hat.