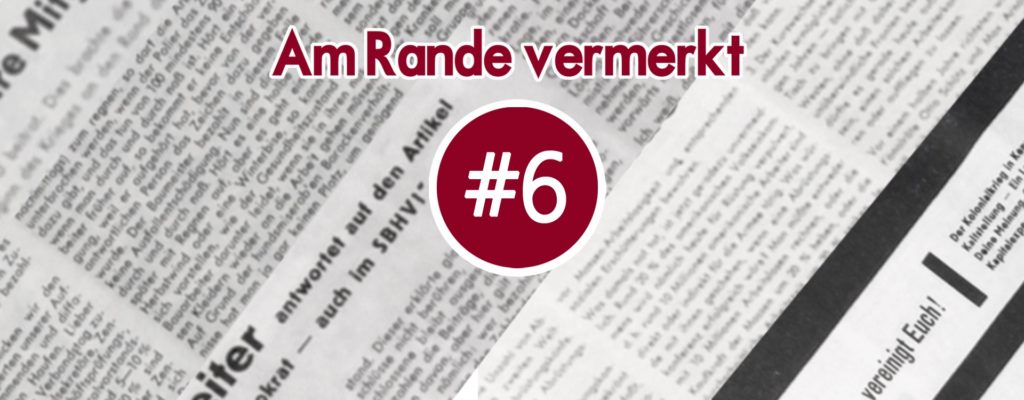Seit Jahren klagen Sozialarbeitende, dass sie als Folge von neoliberaler Sparpolitik viel zu wenig Zeit zur Verfügung haben, um auf ihre Klient*innen bedürfnisgerecht eingehen zu können. Durch die mangelnden zeitlichen Ressourcen ist es unmöglich dem an den Fachhochschulen gelernten Berufsethos nachzukommen oder fachspezifische Methoden anzuwenden (vergleiche Artikel „Soziale Arbeit im Kapitalismus – Teil 2“). Die Arbeit in einem Sozialamt gleicht immer mehr einer bürokratischen Verwaltung von Armut, als einer bedürfnisorientierten Sozialarbeit.
Dass mehr Zeit pro Fall für gute Soziale Arbeit unerlässlich ist, wurde in einer kürzlich veröffentlichten Studie belegt. Die Studie wurde vom Departement Soziale Arbeit der Fachochschule ZHAW, im Auftrag der Stadt Winterthur durchgeführt.
Für die Studie arbeiteten im Rahmen eines Experiments drei Sozialarbeitende in einem Sozialamt der Stadt Winterthur für anderthalb Jahre mit nur 75 anstatt den standartmässigen 140 Fällen (mit denselben Anstellungsprozenten). Die Ergebnisse des Experiments sind keine Überraschung. Bei den Klient*innen der drei Sozialarbeitenden mit tieferen Fallzahlen könnten viel häufiger individuelle Lösungen zur Verbesserungen ihrer Situation gefunden werden. Dies ist gemäss Studie darauf zurückzuführen, dass die Sozialarbeitenden vermehrt Zeit für intensivere und individuell-bedürfnisorientierte Beratungsgespräche investierten.
Die Studie zeigt nicht nur, dass die Arbeitsbelastung bei Sozialarbeitenden im Normalfall viel zu hoch ist, sondern auch, dass für erfolgreiche Soziale Arbeit mehr Zeit zur Verfügung stehen muss, um tatsächlich auf die Bedürfnisse der Klient*innen eingehen zu können. Auch wenn das Grunddilemma zwischen Hilfe und Kontrolle, in welchem sich Sozialarbeitende immer befinden, mit mehr zeitlichen Ressourcen noch nicht aufgelöst werden kann.
Es ist schade, dass sowohl die ZHAW, als auch die Stadt Winterthur in ihren Stellungsnahmen zur Schlussfolgerung kommen, dass mit tieferen Fallzahlen pro Sozialarbeiter*in die Sozialhilfekosten gesenkt werden könnten. So würden pro Jahr in der Stadt Winterthur 1.5 Millionen Franken eingespart werden. Diese Schlussfolgerung gibt der Studie einen faden Beigeschmack und deckt genau diese kostenorientierte neoliberale Denkweise auf, welche Sozialer Arbeit seit Jahren durch Sparmassnahmen und New Public Management erschwert. Gerade von einer Fachhochschule, dessen Exponent*innen sich die Entwicklung der Sozialen Arbeit hin zu einer „Menschenrechtsprofession“ auf die Fahne geschrieben haben (Vergleiche Artikel „Soziale Arbeit im Kapitalismus – Teil 1“), wäre eigentlich zu erwarten, dass die Bedürfnisse der Klient*innen Sozialer Arbeit im Zentrum stehen und nicht die angeblich zu hohen Sozialhilfekosten.
von Elyas Berg
Dass mehr Zeit pro Fall für gute Soziale Arbeit unerlässlich ist, wurde in einer kürzlich veröffentlichten Studie belegt. Die Studie wurde vom Departement Soziale Arbeit der Fachochschule ZHAW, im Auftrag der Stadt Winterthur durchgeführt.
Für die Studie arbeiteten im Rahmen eines Experiments drei Sozialarbeitende in einem Sozialamt der Stadt Winterthur für anderthalb Jahre mit nur 75 anstatt den standartmässigen 140 Fällen (mit denselben Anstellungsprozenten). Die Ergebnisse des Experiments sind keine Überraschung. Bei den Klient*innen der drei Sozialarbeitenden mit tieferen Fallzahlen könnten viel häufiger individuelle Lösungen zur Verbesserungen ihrer Situation gefunden werden. Dies ist gemäss Studie darauf zurückzuführen, dass die Sozialarbeitenden vermehrt Zeit für intensivere und individuell-bedürfnisorientierte Beratungsgespräche investierten.
Die Studie zeigt nicht nur, dass die Arbeitsbelastung bei Sozialarbeitenden im Normalfall viel zu hoch ist, sondern auch, dass für erfolgreiche Soziale Arbeit mehr Zeit zur Verfügung stehen muss, um tatsächlich auf die Bedürfnisse der Klient*innen eingehen zu können. Auch wenn das Grunddilemma zwischen Hilfe und Kontrolle, in welchem sich Sozialarbeitende immer befinden, mit mehr zeitlichen Ressourcen noch nicht aufgelöst werden kann.
Es ist schade, dass sowohl die ZHAW, als auch die Stadt Winterthur in ihren Stellungsnahmen zur Schlussfolgerung kommen, dass mit tieferen Fallzahlen pro Sozialarbeiter*in die Sozialhilfekosten gesenkt werden könnten. So würden pro Jahr in der Stadt Winterthur 1.5 Millionen Franken eingespart werden. Diese Schlussfolgerung gibt der Studie einen faden Beigeschmack und deckt genau diese kostenorientierte neoliberale Denkweise auf, welche Sozialer Arbeit seit Jahren durch Sparmassnahmen und New Public Management erschwert. Gerade von einer Fachhochschule, dessen Exponent*innen sich die Entwicklung der Sozialen Arbeit hin zu einer „Menschenrechtsprofession“ auf die Fahne geschrieben haben (Vergleiche Artikel „Soziale Arbeit im Kapitalismus – Teil 1“), wäre eigentlich zu erwarten, dass die Bedürfnisse der Klient*innen Sozialer Arbeit im Zentrum stehen und nicht die angeblich zu hohen Sozialhilfekosten.
von Elyas Berg
[Am Rande vermerkt] ist eine Serie von Kurzartikeln. Wir wollen damit tagesaktuelles Geschehen kommentieren, einordnen, auf Veränderungen aufmerksam machen. Eine konsequente linke, antikapitalistische Politik zeichnet sich unseres Erachtens nicht nur dadurch aus, die grossen Analysen abzuliefern. Vielmehr gehört es für uns dazu, auch kleinere, unscheinbare Entwicklungen, skandalöse Aussagen und Auffälliges einordnen zu können.
Die kurze Form, der eher flüchtige Charakter und die zeitliche Nähe, die allesamt diese Artikelserie ausmachen, führen dazu, dass die hier geäusserten Einschätzungen vorübergehend sein können und nicht zwangsläufig mit den Ansichten unserer Organisation übereinstimmen müssen. Die Autor*innen und die verwendeten Quellen sind deshalb jeweils gekennzeichnet. Textvorschläge sind jederzeit herzlich willkommen.
Die kurze Form, der eher flüchtige Charakter und die zeitliche Nähe, die allesamt diese Artikelserie ausmachen, führen dazu, dass die hier geäusserten Einschätzungen vorübergehend sein können und nicht zwangsläufig mit den Ansichten unserer Organisation übereinstimmen müssen. Die Autor*innen und die verwendeten Quellen sind deshalb jeweils gekennzeichnet. Textvorschläge sind jederzeit herzlich willkommen.